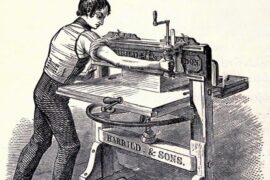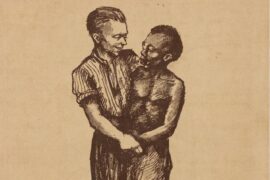Der Neustart des Göttinger Kunsthauses beginnt mit Juergen Tellers Fotostudie »Auschwitz Birkenau«. Sie dokumentiert einen Besuch auf dem Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers und zeigt einen Ort in der Breite seines visuellen und narrativen Spektrums.
Hinweis: Der Autor dieser Besprechung arbeitet im Göttinger Kunsthaus, um das es geht.
Von Gerrit Elsner
Bild: Foto aus dem Bildband Auschwitz Birkenau von Juergen Teller (Steidl Verlag)
Seine zeitweilige Schließung hat das Göttinger Kunsthaus wohlbehalten überstanden. Mit Juergen Tellers Fotostudie »Auschwitz Birkenau«, die bis 1. Juni zu sehen war, ist gerade die erste Ausstellung des neuen Zyklus zu Ende gegangen. Für »Auschwitz Birkenau« war der international renommierte und vor allem in der Modebranche erfolgreiche Fotograf Teller im vergangenen Herbst der Einladung des Schriftstellers Christoph Heubner, Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, gefolgt und hatte über mehrere Tage einen Besuch in der polnischen Gedenkstätte dokumentiert. Im Kunsthaus ausgestellt waren nahezu alle der über 800 Aufnahmen, die als Buch im Steidl Verlag erschienen sind. Hinzu kam ein von Christoph Heubner und der Künstlerin Michèle Déodat als »Institute to Remember« kuratierter Raum mit Selbstzeugnissen verschiedener Holocaust-Überlebender. Außerdem flankierte ein eng getaktetes Begleitprogramm aus Rundgängen und Veranstaltungen die Ausstellung, unter anderem war RP Kahls Verfilmung von Peter Weiss‘ »Die Ermittlung« zwei Wochen lang in Dauerschleife zu sehen.
Artefakte der Tat
Im Foyer weisen zwei große Schautafeln detailliert die Lagepläne der Vernichtungslager »Auschwitz I« (sog. »Stammlager«) und »Auschwitz II« (»Birkenau«) aus. Über drei Ausstellungsräume und ebenso viele Etagen erstrecken sich mit Tellers iPhone aufgenommene Bilder in kleinem Format. Nicht jedes Foto stellt ein eigenes Motiv dar, in der Regel sind ähnliche Einstellungen nebeneinander gruppiert. Nahtlose Übergänge verleihen der Betrachtung eine Dynamik, die dem Blättern im Buch oder einer streifenden Filmaufnahme gleicht und die mit der Bewegungslosigkeit der Gegenstände kontrastiert: Erstarrte Ziegelsteinruinen, kahle Herbstvegetation, stille Gedenkorte.
Gewissenhaft werden im begleitenden Katalog die Inhalte der Fotoserie kontextualisiert: Ein rechteckiger Feuerlöschteich im Stammlager, auf SS-Befehl als Schwimmbad angelegt. Die »Todeswand«, Schauplatz zahlloser Erschießungen und nicht im engeren Sinne eine Wand, sondern ein speziell angefertigter Kugelfang. Es folgen SS-Schreibstuben, die inzwischen tausendfach zum Fotomotiv gewordene »Judenrampe«, Schienen, Stacheldraht, Zellen, Latrinen, Straßen, die alles verbinden, matschig vom Herbst. Details von Wänden, Ziegeln und Türrahmen, Ausblicke von Wachtürmen auf Leere und Weite des 190 Hektar großen Lagergeländes, Galgen und Folterinstrumente, schauerliche Relikte der Vernichtungsindustrie bis hin zu den Dosen des Giftgases »Zyklon B«. Aber auch zu sehen sind Wiesen, Gestrüpp, Maulwurfshügel. Natürlicher Wuchs, den die planierte Barackenlandschaft, die Todesfabrik hier niemals zugelassen hätte.1Für den Fotografen Juergen Teller bildet die sich einen Weg bahnende Natur ein wiederkehrendes Thema. In »Nürnberg« (2006) besuchte er das Reichsparteitagsgelände und zeigte dessen Verfall und die Übernahme durch Gräser, Blumen und Büsche.
Angeordnete Authentizität
Und manchmal stehen dort Menschen. Besucher:innen, der Fotograf hinter seinem Smartphone ist einer von ihnen, säumen vereinzelte Bildränder. Sie sind auf den überwiegend unbelebten Ansichten eine Ausnahme, umso augenfälliger die Eindrücke, die sie hinterlassen, wenn sie hin und wieder in ihr Zentrum gerückt werden: ein knallgelber Reisebus mit der Zielanzeige »Auschwitz-Birkenau«, Neontafeln, die »Parking« ausschildern, junge Besucher:innen, die Pause an Gleissträngen machen, große Auslagen von Ansichtskarten, dutzende Motive kosten je 20 Złoty, die sich auch in ein »Hot-Baguette« am Parkplatz investieren lassen. Wer hier verharrt, ist vielleicht irritiert, geködert und verführt von der Idee, Auschwitz sei heute ein »authentischer« Ort. Eine Illusion, die an touristischer Infrastruktur zerschellt. Dass Juergen Teller letztere nicht zugunsten einer womöglich ungestörteren Betrachtungserfahrung ausblendet, ist eine zentrale ästhetisch-künstlerische Entscheidung. Das komplizierte Neben-, In- und Miteinander von empfundener »Authentizität« (in der Form bröckelnder Ruinen und historischer Artefakte wie der Giftgasdosen) und ihrer musealer Aufbereitung zu einem Lern- und Erinnerungsort hält die Gefahr bereit, dass Besucher:innen eine »natürliche Ordnung« (James Young) zu erkennen glauben und das geschehene Grauen mit seiner kuratierten Repräsentation verwechseln.2Siehe James E. Young: The Texture of Memory. Holocaust Memorials and Meaning, New Haven und London 1993, hier S. 128. Dieses Spannungsverhältnis von historischer Wahrheit und ihrer (nicht per se verwerflichen, aber eben distinkten) touristischen Gangbarmachung transportieren Tellers Fotos mit einem unverstellten Blick.
Die Bilder schließen so an ein entstehendes ›Genre‹ alternativer Sichtbarmachungen des Tat- und Gedenkorts Auschwitz an. Der französische Dokumentarfotograf Frédéric Mougenot etwa präsentierte zum 75. Jahrestag der Befreiung Aufnahmen, die sich vom ikonographischen Zentrum der Lagergedenkstätte ab- und dessen Peripherie zuwandten, zum Beispiel Fabrikruinen des Konzentrationslagers »Auschwitz III« (»Monowitz«), aber auch den nicht-öffentlichen ›inner workings‹ der heutigen Gedenkstättenarbeit.3Siehe Frédéric Mougenot: Auschwitz. Bild und Hinterbild, Berlin 2022.
Die vielen Schichten der Erinnerung
In Tellers Dokumentation überlagern sich Zeitebenen und verschiedene Perspektiven auf einen Ort und seine (Nach-)Geschichte. Begonnen mit Selbstzeugnissen der Häftlinge, heimlich in Wände gekratzten Namen und Daten oder auf Papierresten festgehaltenen Zeichnungen. Ihre Zeugenschaft haben viele Überlebende in den Jahrzehnten nach der Befreiung fortgesetzt, künstlerisch verarbeitet und dokumentiert, wie z.B. die Malerin Janina Tollik in ihren Gemälden von Lageralltag und Lagerlandschaft oder Marian Kołodziej in Zeichnungen, deren todesnahe Protagonist:innen aus dem Werk heraus- und ihre Betrachter:innen zwingen, zurückzustarren. In Auschwitz sind viele solcher Exponate versammelt, und auch diese erinnerungskulturellen Ausstellungselemente finden als ›Bilder in Bildern‹, auf einer Art sekundären Beobachtungsebene, in Tellers Aufnahmen statt.
Seit dem 27. März – und damit nur wenige Monate nach seiner bundesweit bedauerten Schließung – hat das Kunsthaus in der Düsteren Straße wieder geöffnet. Unter Mitwirkung des Steidl Verlags sowie des Literaturherbstes ist ein Programm aus „Blockbuster-Ausstellungen“ entstanden, wie es Anfang März in einer Mitteilung der Stadt Göttingen hieß, in deren Trägerschaft sich das Unternehmen befindet. Einiges hat sich mit dem Neustart geändert (etwa werden inzwischen Eintrittspreise erhoben), anderes ist geblieben – nicht zuletzt seine überregionale Anziehungskraft.
Mitunter fällt es trotz Katalog schwer, die in der schnellen Abfolge ihrer fotografischen Aufreihung zu einem gemeinsamen Erfahrungsraum zusammenlaufenden Motive einzuordnen, zu sortieren. Wenn Fotos einer graffitiübersäten Fabrikruine (»Fuck System«) in farblich und strukturell nicht ganz unähnliche Impressionen von Gerhard Richters abstraktem Gemäldezyklus »Birkenau« übergehen, der vor Ort ausgestellt ist, ergibt sich eine Gesamterfahrung, die ihren Wert (auch) aus ihrer Komplexität bezieht.
Von der Betrachtung zur Handlung
»Auschwitz Birkenau« ist reich an Motiven, Details, Botschaften und Interpretationsvorschlägen, Störelementen und offenen Fragen. Das von Christoph Heubner und Michèle Déodat verantwortete »Institute to Remember« bietet dazu dankenswerte Einordnungen und ergänzt die unentbehrlichen Perspektiven der Überlebenden.
Eine Videoinstallation etwa berichtet von der ungarischen Jüdin Eva Fahidi, die als einzige aus ihrer Familie die Lager überlebte. Im Jahr 2016 inszenierte sie im Alter von 90 Jahren ein Tanztheaterstück, das die Erfahrungen ihres Lebens verarbeitete. Ebenfalls zu sehen ist die 2016 aufgenommene Brandrede der Wiener Auschwitz-Überlebenden Gertrude Pressburger, die darin vor der Wiederkunft von Demokratie- und Menschenfeindlichkeit warnte und mahnte, nicht nur »im kleinen Kreis groß [zu] reden«, sondern sein »Recht als Bürger in Anspruch [zu] nehmen«.
So wird der Weg beschrieben von Auschwitz, dem Schauplatz des Verbrechens und Ausgangspunkt dieser Ausstellung, zu seinen ideellen Ursprüngen, dem Hass und denen, die ihn in die Tat umgesetzt oder seiner Umsetzung ›tatenlos‹ beigewohnt haben. Natürlich ist auch Juergen Tellers Fotostudie also eine Handlungsaufforderung, auch wenn sie keinem augenblicklich hervortretenden appellativen Schema folgt – sondern in erster Linie einer Kamera auf der Suche nach kleinen und großen Details.