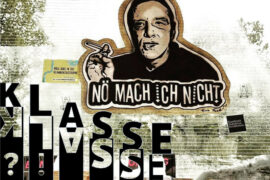Sind die Menschen Produkt ihrer sozialen Herkunft oder können sie sich von deren Einfluss befreien? Die französische Philosophin Chantal Jaquet veröffentlichte im Jahr 2018 zu diesem Thema eine Studie: Zwischen den Klassen. Die Nicht-Reproduktion sozialer Macht. Sie widmet sich hier der Aufgabe, das Phänomen der sozialen Überläufer:innen zu erklären.
Von Kristina Tanner
Überläufer:innen sind Personen, die im Verlauf ihres Lebens von einer sozialen Klasse in eine andere auf- oder absteigen. Wenn jemand aus prekären Verhältnissen stammt und trotzdem Professor oder Nobelpreisträgerin wird, dann scheint dies ein Beleg dafür zu sein, dass Menschen den Verlauf ihres Lebens prinzipiell selbst bestimmen können.
Die Arbeiten des Soziologen Pierre Bourdieu legen jedoch das Gegenteil nahe: Er weist durch aufwendige empirische Forschung nach, dass wir im Erwachsenenalter in der Regel lediglich jenes Verhalten reproduzieren, das in der Herkunftsfamilie erlernt wurde. Jaquet schreibt in ihrer Studie gegen diesen Gedanken an. Anhand autobiografischer Schriften von Didier Eribon und Annie Ernaux entwickelt sie die These, dass tiefgreifende persönliche Krisen (wie familiäre Gewalt oder das Erleben von Ausgrenzung) bei manchen Menschen zu einer inneren Abwendung vom Herkunftsmilieu führen können. Sie zeigt, dass Extremerfahrungen und Vorbilder aus anderen sozialen Klassen als Katalysatoren für einen sozialen Aufstieg wirken können. Der Text fragt damit grundsätzlich, wie Klassenwechsel trotz struktureller Hürden möglich ist – und welche Rolle individuelle Erfahrung, Bildung und Orientierung an anderen Lebensentwürfen dabei spielen.
Was ist soziale Reproduktion?
Da Bourdieus Theorie der sozialen Reproduktion eine entscheidende Grundlage für Jaquets Studie bildet, soll sie an dieser Stelle kurz umrissen werden: Obwohl wir alle in derselben Gesellschaft leben, gehören Menschen je nach Einkommen, Beruf und Bildung der Eltern, ganz unterschiedlichen sozialen Gruppen an. Jede dieser Gruppen zeichnet sich durch einen bestimmten Lebensstil, typische Routinen sowie bestimmte Selbstverständlichkeiten und Überzeugungen aus. Es ist daher statistisch sehr unwahrscheinlich, dass Menschen aus unterprivilegierten sozialen Schichten in der Schule Erfolg haben: Sie leben gewissermaßen in einer anderen „Kultur“ als manche ihrer Mitschüler:innen, die aus wohlhabenderen und gebildeteren Familien stammen. In sozioökonomisch benachteiligten Milieus beschränken sich finanzielle Ressourcen meist auf das Lebensnotwendige. Kulturelle Interessen – etwa an Kunst oder klassischer Bildung – gelten oft als unpraktisch oder elitär. Bourdieu spricht hier vom »Notgeschmack«, einem durch materielle Bedingungen geprägten Geschmack, der als unbewusste Selbstbegrenzung verstanden werden kann. Hierdurch wird ein soziales »Überlaufen« nahezu unmöglich. Der Mensch neigt zur Wiederholung dessen, was er kennt, und vor allem wiederholt er immer wieder das Verhalten, das er früh und unbewusst erlernt hat.
Berühmte Überläufer:innen
Gleichzeitig gibt es aber Überläufer:innen. Ein Beispiel hierfür ist die Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux, die eigentlich aus einem familiären Umfeld stammt, in dem niemand über eine akademische Ausbildung oder ökonomischen Wohlstand verfügt. Lebenswege wie ihrer erregen Aufsehen, da sie aus soziologischer Perspektive extrem unwahrscheinlich sind.
Reihe Klasse?!
Was ist das, eine Klasse? Haben wir alle eine? Wie prägen Klassen und Ideen von Klassen unseren Gesellschaften und den Umgang miteinander? Wie stellt man sie dar? Und wie können wir uns dazu verhalten? In dieser Reihe machen sich die Autor:innen Gedanken über gegenwärtige Gesichter von Klasse und Klassismus. Sie entwickeln sie beispielsweise anhand von literarischen Texten oder Sachbüchern, im Theater, als Forschende und persönlich. Die Texte erscheinen in unregelmäßigem Abstand; sie sind hier zu finden.
Während Bourdieu das Phänomen der sozialen Reproduktion – jede:r macht das, was sie:er von zu Hause kennt – sehr genau und umfassend analysiert, wird die Nicht-Reproduktion, das ›soziale Überlaufen‹, in seinem Werk nur am Rande behandelt. Diese Lücke in Bourdieus soziologischer Theorie möchte Jaquet mit ihrer Studie schließen.
Klassenwechsel durch Krise
Wie kann das soziologisch unwahrscheinliche Überlaufen erklärt werden?
Jaquet analysiert in ihrer Studie in erster Linie die Schriften des Bourdieu-Schülers Didier Eribon und der Schriftstellerin und passionierten Bourdieuleserin Annie Ernaux. Sie stellt fest, dass beide in ihrer Jugend extreme Erfahrungen machen mussten: Eribon erlebte in seiner Herkunftsfamilie starke Ablehnung, da sich seine Homosexualität mit der Zeit immer mehr offenbarte. Ernaux war damit konfrontiert, dass ihr Vater ihre Mutter umbringen wollte. Diese und andere Extremerfahrungen trugen laut Jaquet dazu bei, dass sich beide jeweils von ihrem Herkunftsmilieu entfremdeten.

Zwischen den Klassen
Übersetzt von Horst Brühmann
Konstanz University Press: 2018
253 Seiten, 30 €
Vorbild als Sprungbrett
In den Texten der beiden in Zwischen den Klassen behandelten Autor:innen wird deutlich, dass diese irgendwann damit begannen, in anderen sozialen Kreisen unbewusst nach Vorbildern zu suchen. Sie hielten, so Jaquets Interpretation, die in ihren Herkunftsfamilien herrschenden Spannungen nicht mehr aus und entwickelten eine Sehnsucht nach einem anderen Leben. Ernaux orientierte sich in ihrem Verhalten und ihrer Weltsicht an einer Lehrerin, Eribon verliebte sich unbewusst in einen Mitschüler, dessen Vater Professor war. Auf diesem Weg, so Jaquets These, erlernten beide eine Lebensweise, die für ihr Herkunftsmilieu eigentlich untypisch war: Sie befassten sich mit anspruchsvoller Literatur und Philosophie und nahmen die Schule ernster als viele ihrer Mitschüler:innen. Es war ihnen ein Bedürfnis, sich der Lebensweise jener neuen Vorbilder anzupassen. Hierdurch entfremdeten sie sich zwar noch stärker von ihren Herkunftsfamilien, legten aber gleichzeitig bereits die Grundlagen ihres sozialen Aufstiegs.
Was leistet Jaquets Studie?
Jaquet entwickelt in ihrer Studie einen interessanten ersten Erklärungsansatz zum Phänomen der Überläufer:innen. Problematisch erscheint die Tatsache, dass sie ihre Argumentation fast ausschließlich auf die autosoziobiographischen Texte von Ernaux und Eribon stützt. Der wissenschaftliche Status dieser Texte ist noch nicht abschließend geklärt. Knapp ausgedrückt: Autobiographien werden aus einer sozial privilegierten Position heraus geschrieben und das bringt notwendigerweise Verzerrungen mit sich. Es bleibt daher noch genauer zu diskutieren, wie belastbar Jaquets soziologische Einsichten tatsächlich sind und welchen Beitrag zur soziologischen Diskussion Eribon und Ernaux mit ihren Texten leisten können. Jaquets Studie ist insofern eine anspruchsvolle Lektüre, als hier die Begrifflichkeiten und die theoretischen Überlegungen Pierre Bourdieus vorausgesetzt werden. Gleichzeitig handelt es sich um ein gut lesbares Buch, da abstrakte soziologische Überlegungen immer wieder an konkreten Beispielen diskutiert und plausibilisiert werden. Insgesamt kann Jaquet zugutegehalten werden, dass sie sich einem theoretisch wenig erforschten Gegenstand der Soziologie (den Überläufer:innen) genähert hat.