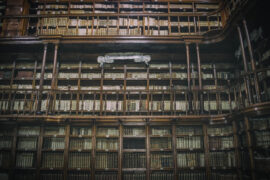Eine kurdische Familie flüchtet in die Niederlande. Cemile Sahin kreuzt in ihrem Kommando Ajax kurdische Migrationsliteratur mit komischem Heimatkrimi. Damit lässt sich arbeiten. Sahin setzt aber noch einen drauf; doch verhebt sich an einem unausgereiften »Actionfilm«-Stil.
Von Jonas Darboven
Bild: Jonas Darboven
Sechs Geschwister müssen ihr Heimatdorf Mezra in der kurdischen Region Dersim verlassen. Asyl suchen sie in den Niederlanden, wo es ein neues Leben aufzubauen gilt. Von der Traufe in den Regen, denn hier wird es nur scheinbar besser. Eine Hochzeit führt zu Mord, Diebstahl und Erpressung, wobei die schnellen Handlungssprünge mit reichlich Witz erzählt werden. Lobenswert hervorzuheben sind die Illustrationen, die mit ihrer gelben Schrift und den roten Rahmen einen (wenn auch stereotypen) Eindruck kurdischer Kultur erzeugen. Das allein wäre bereits ein Alleinstellungsmerkmal, doch Sahins Text ist außerdem ein stilistisches Experiment.
Der Roman ist kein ›Roman‹ im engeren Sinne. Selbst bewirbt sich das Buch mit dem »Stil eines Actionfilms«. Dabei wird jedoch das Tempo eines Films durch prosaische Passagen unterbrochen und selbst der Vergleich mit einem Drehbuch würde der Form nicht gerecht. Es hat Züge des absurden und historischen Dramas, nur lesen sich Regieanweisungen nicht so schön, wie sie sich aufführen lassen würden. Das zeigt sich etwa an den Rückblenden, die mit der Subtilität eines Vorschlaghammers für einen spontanen Szenenwechsel in fettgedruckte Zwischenüberschriften gerahmt werden, sodass es regelmäßig heißt:
»Zeitsprung. Rückblende.«
Nach dem Ersten Weltkrieg, insbesondere durch den Vertrag von Lausanne 1923, wurde das kurdische Siedlungsgebiet auf mehrere Staaten aufgeteilt: Iran, Irak, Türkei und Syrien. Für eine eigenständige kurdische Identität blieb kein Raum. Als 1936 der kurdische Ortsname ›Dersim‹ in das türkische ›Tunceli‹ umbenannt wurde, spitzte sich der Konflikt weiter zu. Der sogenannte Dersim-Aufstand 1937/38 endete in einer massiven Repressionskampagne. Nach Schätzungen der International Association of Genocide Scholars von der University of California wurden dabei etwa ein Drittel der 150.000 kurdischen Bewohnerinnen und Bewohner getötet.
In Kommando Ajax flüchtet Familie Korkmaz 1994 in die Niederlande. Hier denkt der für den Asylantrag der Familie zuständige Sachbearbeiter, er hätte es mit einem »Türk« zu tun, weil er das Wort »Kürt« nicht zuordnen kann. Da die Sprachbarriere im Weg steht, wird kurzerhand die Herkunft »Kuba« eingetragen. Im Fall der Autorin Sahin verläuft die Bewegung in die entgegengesetzte Richtung: 1990 in Wiesbaden geboren, verbringt sie ihre Kindheit im ost-türkischen Tunceli. Dort ist Dersim bis heute ein unvergessener Ort und politisierter Begriff, den Sahin nun nach Deutschland bringt. Besonders in Zeiten der umstrittenen Migrationspolitik ist ein empathischer Einblick in kurdische Geschichte und Erfahrung höchst willkommen.
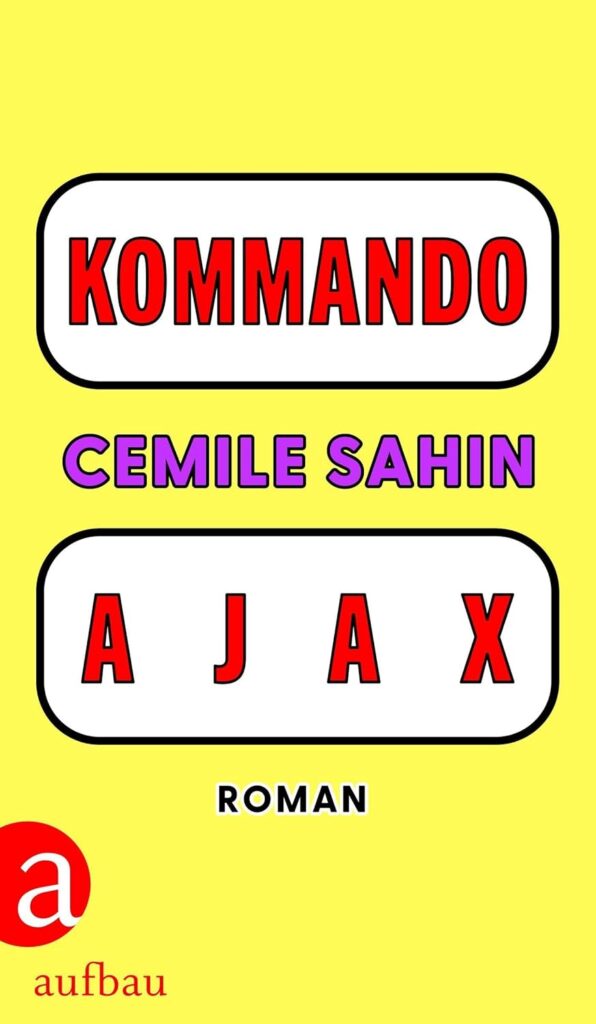
Kommando Ajax
Aufbau Verlag: 2024
351 Seiten, 25 €
»Zeitsprung. Rückblende vorbei.«
Die Idee, ein Buch wie einen Film zu erzählen, ist fruchtbar – dazu muss aber ein passender Erzählstil her. Sahins Stimme gibt Marker für Schnitt und Bild. Die Lesenden werden dadurch zu Filmschaffenden oder, weniger euphorisch, zu Kameras: »Eine weite Landschaft. Die Sonne wandert über Hügel. Über Berge. Zoom auf einen Gipfel. Die Sonne blendet. Zoom auf ein Lehmhaus. Eine Ziegenherde läuft durch das Bild. Zoom auf einen Birnenbaum, der vor dem Lehmhaus steht. Zoom out.« Diese Sprache eignet sich für eine experimentelle Kurzgeschichte, wird in einem Roman aber schnell dröge.
Auch die Interpretationsansätze, das infinite Geheimwaffenarsenal jedes Werkes, das sein Lesepublikum lange beschäftigen und im Gespräch darüber halten möchte, werden vorweggenommen: »Was bedeutet das? Ein Sohn blickt zu seinem Vater auf. Es bedeutet: Familie bedeutet alles.« Kommando Ajax nimmt die eigene Auslegung ab. Wo ein tobendes Kind bereits genug ausdrücken würde, entscheidet sich Sahin für ein Ausbuchstabieren: »Die Schnelligkeit bedeutet hier: Ungeduld.« Und schon erwischt man sich dabei, wie man eine Seite nach der nächsten umblättert. Kurze Sätze, häufige Zeilenbrüche und viele Leerzeilen beschleunigen diesen Prozess und pusten selbst ruhige Momente im Sturm hinweg. Was die Schnelligkeit wohl hier bedeutet?
»Zeitsprung.« Schon wieder?
Die Hintergründe, von denen Sahin erzählen möchte, sind bewegend. Gerade deshalb sollten sie in einem Roman gut erzählt werden. Auch wenn ihr Werk und ihr »Actionfilm«-Stil von der Presse hoch gelobt wurden, ist das noch nicht das Ende dieser Stilrichtung. Es liest sich wie ein experimenteller Rohentwurf, dem vor der Veröffentlichung noch Überarbeitung und Feinschliff gutgetan hätten. Dann erst fasziniert nicht (nur) die Idee, sondern der Roman. Es bleibt abzusehen, ob Cemile Sahin diesen Stil in Zukunft noch ausbauen kann.