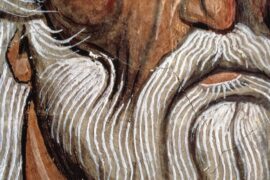Rebekka Endler entlarvt in Witches, Bitches, IT-Girls patriarchale Mythen, die Geschichte und Gegenwart prägen. Mit pointiertem Witz, fundierter Recherche und intersektionalem Blick dekonstruiert sie Herrschaftserzählungen – und kombiniert so Zerstörungspotenzial mit Hoffnungsschimmern.
Von Katarina Fiedler
»Pandora, die blöde Bitch, ist schuld an allen Übeln dieser Welt – womit sie nicht allein ist, auch Eva und ihre biblischen Nachfahrinnen […] sowie alle Femmes fatales der antiken Mythologie gehören dazu, denn der Autor ist: das Patriarchat«. Bereits dieser Satz im einleitenden Kapitel packt die Leser:innen, wenn sie das Sachbuch das erste Mal in der Hand halten – man kann es nach dieser Anklage kaum wieder weglegen. Witches, Bitches, IT-Girls von der Sozialwissenschaftlerin und Journalistin Rebekka Endler (Das Patriachat der Dinge (2021)) entwickelt gleich auf den ersten Seiten einen Sog, der seine Wirkung nicht verlieren wird.
Die Welt, deren Mythen Endler beschreibt, ist allen Leser:innen bekannt und doch möchte man dies an einigen Stellen weit von sich weisen: Über die kollektive Realität des alltäglichen Zusammenlebens haben – das zeigt die Autorin – nämlich nur einige wenige die Deutungshoheit und üben damit Macht auf Denken und Verhalten aller aus. Sei es das Übersetzen literarischer Werke, Profisport, Aktivismus oder Geschichtsdeutung: Männer bestimmen seit Jahrtausenden, wie Frauen gesehen und wie ihre Errungenschaften bewertet werden.
In Endlers differenzierter Spurensuche verknüpft sie auf radikal-pointierte Weise historische und zeitgenössische Ereignisse mit übergeordneten patriarchalen Mythen und dekonstruiert diese mittels kultur- und sozialwissenschaftlicher Analysen. Die detaillierte Recherche, die Endler mit wissenschaftlich präziser und gleichzeitig zugänglicher Sprache verarbeitet, besteht aus umgangssprachlichen Witzen, kulturwissenschaftlichen Einordnungen, zahlreichen Beispielen und subjektiven Kommentaren. Das Zusammenspiel dieser Elemente macht aus dem Sachbuch eine unterhaltsame, aufrüttelnde und lehrreiche Lektüre.
»Die bekanntesten Erzählstränge unserer Menschheitsgeschichte triefen nur so von patriarchaler Prägung, während Bringschuld und Beweislast für Korrekturen immer bei uns liegen: den Feminist*innen.«
Der Mythos des »Normalen«
Im ersten Kapitel legt sie zunächst einen Grundstein für ihre folgenden Ausführungen, indem sie dekonstruiert, was gesellschaftlich als »normal« und damit erstrebenswert gilt. Endler bringt anschaulich auf den Punkt, dass Normalität nichts anderes als eine jahrhundertealte Erzählung ist, die versucht, Menschen in eine Schablone zu pressen und alle, die nicht in die Schablone passen (können/wollen), als »falsch« zu diskreditieren. Wer sich schon einmal mit diesen Normalitätskonstruktionen beschäftigt hat, erfährt zwar zu Beginn wenig Neues, doch die Basis für alles Folgende ist damit erst einmal solide geschaffen.
Der Untertitel des Buches, Wie patriarchale Mythen uns bis heute prägen, verdeutlicht den kulturwissenschaftlichen Anspruch Endlers Arbeit, in der sie zahlreiche Beispiele als das entlarvt, was sie sind: die Kontrolle über das alltägliche Zusammenleben, ausgeübt durch Männer. Ein Mythos, so wie er im Metzler Lexikon Literaturdefiniert ist, ist eine »Erzählung, die einen nicht beweisbaren, kollektiv wirksamen Sinn stiftet«1Mythos, in: Metzler Lexikon. Literatur. Hg. von Burdorf/Fasbender/Moenninghoff, 2007, S. 524f.. Er dient also dazu, bestimmte Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu erhöhen, andere zu erniedrigen sowie vereinzelte als »wir haben das schon immer so gemacht« zu klassifizieren.
Wenn Archäologie erzählt, was sie nicht weiß
Dazu gehören etwa die stereotypischen Geschlechterrollen im Haushalt – »sogar die ersten Menschen hatten die Aufteilung, dass Männer die Familie ernährten!« Hatten sie das? Endler zeigt unter anderem im Kapitel zur Geschichtsschreibung über Neandertaler:innen: Nein, hatten sie nicht. Während zwar das Bild vom jagenden Mann und der sammelnden Frau fest im kollektiven Gedächtnis verankert ist, stellt Endler heraus, dass diese Erkenntnisse auf Knochenfunden beruhen, die eigentlich gar keinen Rückschluss auf die Tätigkeiten der einzelnen Menschen einer Neandertalergruppe zulassen. In der prägenden Phase der Archäologie war es aber verlockend, die patriarchale Weltordnung des erwerbstätigen Alleinversorgers und der Hausfrau bereits als in der Steinzeit begründet zu propagieren, sodass sich dieser Mythos fortan in allen Geschichtsbüchern wiederholt. Dieses Beispiel soll zunächst genügen, um ihren Anspruch von Dekonstruktion, dem Endler durchweg gerecht wird, zu verdeutlichen und auch die Wirkung ihrer Analysen herauszustellen: »Das Gegengift zur patriarchalen Erzählung lag die ganze Zeit in ihr selbst, und daran hat sich möglicherweise bis heute nichts geändert.«
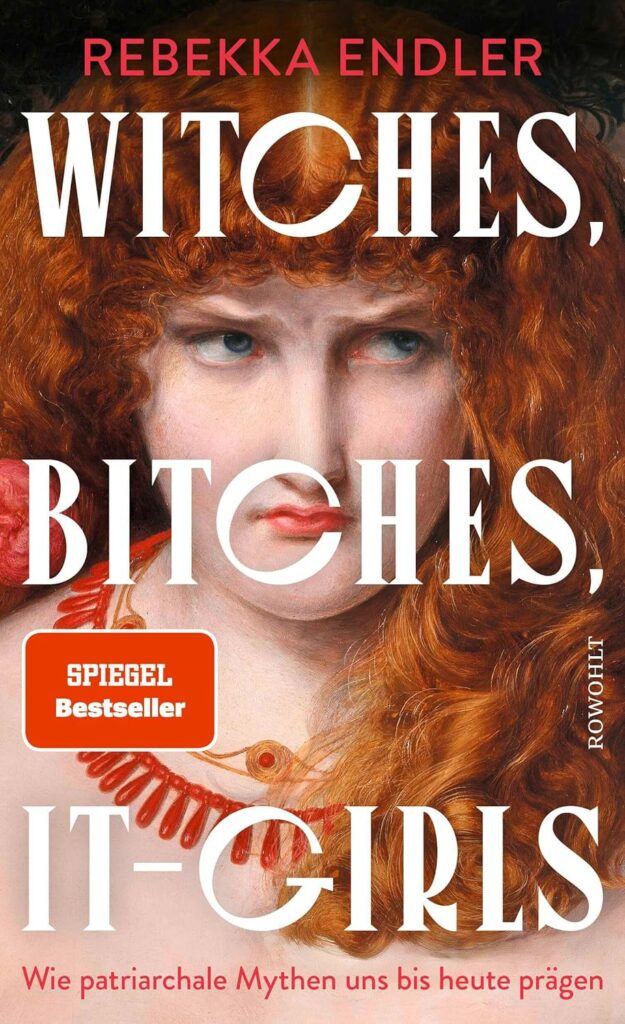
Witches, Bitches, IT-Girls
Rowohlt: 2025
464 Seiten, 25 €
Was jedoch bereits beim ersten Kapitel stört und sich bis zum neunten Kapitel nicht ändert: Endler verwendet sowohl Fußnoten als auch Endnoten als auch Quellenangaben mit hochgestellten Zahlen. So kommt es, dass das Lesen zu einer akrobatischen Meisterleistung wird, bei der der kleine Finger auf der aktuell gelesenen Seite verweilt, während der Daumen circa 350 Seiten weiter hinten die entsprechende Seite mit den Endnoten fixiert, um schnell umblättern zu können. Es ist bisweilen uneindeutig, welcher Funktion die einzelnen Kommentararten gelten: Mal ist in der Fußnote auf derselben Seite eine kurze Begriffsdefinition festgehalten, mal findet sich diese Definition in wesentlich ausführlicher aber auch in den Endnoten, die sonst primär den persönlichen Anekdoten der Autorin dienen. Diese sind allerdings immer spannend und aufschlussreich, sodass das Buch mit geübtem Lesefluss herrlich wegzuschmökern ist.
Wem erinnert wird – und wem nicht
An einzelnen Stellen zieht sich Endlers Reise etwas zäh durch Jahrhunderte patriarchal geprägter Mythen und moderner Abwandlungen, sobald sie jedoch ins Erzählen kommt, wie etwa in der Geschichte über Profiboxerin Chyna, liest sich ihr Sachbuch wie ein Roman und wird zum Lesegenuss, bei dem die Zeit schnell in Vergessenheit gerät.
Endler verwebt dabei in zahlreichen Unterkapiteln intersektionale Kämpfe miteinander, anhand derer unübersehbar wird, wie eng verknüpft verschiedene Formen der Diskriminierung durch patriarchale Strukturen sind: Ihr erstes Kapitel widmet sie gezielt trans Personen, im weiteren Verlauf verknüpft sie feministische Kämpfe mit Klimaschutz, dem US-amerikanischen Civil Rights Movement oder dem Widerstand gegen rassistische Diskriminierung. Dabei glorifiziert sie jedoch nicht, sondern – im Gegenteil – räumt mit verklärten Mythen um ›besondere‹ historische Persönlichkeiten auf. Das macht sie auf respektvolle Weise, aber mit pointierter Genauigkeit, die die narrative Auslöschung Vieler zugunsten einzelner Held:innen unmissverständlich aufzeigt.
Emotionen in voller Bandbreite
Die Lektüre des Sachbuches erzeugt auf 462 Seiten alle Emotionen, die eine Zusammentragung jahrhundertealter Mythen, von denen der eigene Alltag betroffen ist, begleiten sollten: Wut und pure Fassungslosigkeit über Narrative von Manfluencern, die sexualisierte Gewalt rechtfertigen, gefolgt von Überraschung und Lachen über alternative Geschichtsdeutungen. Neben bereits bekannten Mythen und empörenden Begebenheiten führt Endler nämlich auch nischige Lesarten auf, so etwa die Frage, ob Ovid mit seinen Heroides (Briefe bekannter Heldinnen an abwesende Männer) die erste queere Fanfiction über mythologische Männer geschrieben habe. Kurzgesagt: Witches, Bitches, IT-Girls ist ein sprachlicher Genuss, der die omnipräsente Misogynie und kollektive Normalitätsvorstellungen auf Kosten zahlreicher unterdrückter Gruppen auf den Punkt bringt, mit angemessener Empörung garniert und am Ende dennoch Platz für Hoffnung lässt. Denn: Die kollektive Kraft der Hoffnung entkam ebenfalls aus Pandoras Büchse.