In seinem Roman Einübung ins Schweben führt der Schriftsteller Dževad Karahasan hinab in das Tal Sarajevos, hinab in ein dantisches Inferno und zeigt die Metamorphose eines Humanisten.
Von Maximilian Menzel
Bild: Maximilian Menzel (Monument in Sarajevo, das auf die Toten der Belagerung verweist)
Man sollte stets vorsichtig mit Lobpreisungen sein, aber wer schon einmal den bosnisch-herzegowinischen Schriftsteller Dževad Karahasan hat sprechen hören, und sei es auch nur in einem Video auf Youtube, der ist erst einmal baff, was man aus der deutschen Sprache alles rausholen kann. Kein Wort fällt hinten runter, ein jedes erfährt Berechtigung. Karahasans Umgang mit Sprache, gleichviel ob deutscher oder bosnischer, beweist ein handwerkliches Können, das sich nicht nur in der gesprochenen, sondern auch in seiner geschriebenen Sprache zeigt.
Als Dozent für Dramaturgie und Dramengeschichte an der Akademie für szenische Künste der Universität Sarajevo erlebte Karahasan das erste Jahr der Belagerung der Stadt Sarajevo durch die Armee der bosnischen Serben, Einheiten der jugoslawischen Bundesarmee sowie paramilitärischer Verbände. Die Belagerung Sarajevos, die am längsten anhaltende des zwanzigsten Jahrhunderts, war nicht nur ein zentrales Ereignis während des Bosnienkrieges (1992–1995), sondern auch von entscheidender Bedeutung in Karahasans Schaffen. Bereits 1993 verarbeitete Karahasan diese Zeit in seinem Schlüsselwerk Tagebuch der Übersiedlung. Nun, dreißig Jahre später, liegt mit Einübung ins Schweben ein Roman vor, der sich auf fiktionale Weise erneut mit der gleichen Thematik auseinandersetzt. Nur wenige Monate vor Karahasans Tod erschien sein letztes Werk – Einübung ins Schweben (Uvod u lebdenje, 2022) – in der Übersetzung von Katharina Wolf-Grießhaber im Suhrkamp Verlag.
Ähnlich wie Ivo Andrić in Die Brücke über die Drina eine literarische Chronik einer Brücke zeichnet und doch eigentlich in für sich stehenden Episoden Figuren beschreibt, die mit eben jener Brücke in Verbindung stehen, porträtiert Karahasan Sarajevo in seinem Roman. Es ist die belagerte Stadt, die herangezogen wird, um so die dort lebenden Figuren und ihren Alltag zu erzählen und darüber hinaus die zentralen Fragen der Menschheit an ihr zu reflektieren. Der direkte Bezug auf die platonische Denklehre und die antike Mythologie machen den Roman so universell und zeitlos.
Was ist der Mensch?
Die Handlung des Romans setzt wenige Tage vor Beginn der bereits absehbaren Belagerung Sarajevos ein. Nach einer erfolgreichen Lesung steht der walisische Altphilologe und Mythenforscher Peter Hurd seinem bosnischen Übersetzer Rajko Šurup am Busbahnhof Sarajevos zur Verabschiedung gegenüber. Doch Hurd entscheidet sich kurzerhand um und eröffnet seinem Gegenüber sein Vorhaben, mit ihm in der Stadt zu bleiben.
»Hier kann ich mein wirkliches Selbst kennenlernen, kann die Authentizität entdecken, kann entdecken und begreifen, wer ich bin und wie ich tatsächlich bin.«
Was den sechzigjährigen Hurd zum Bleiben bewegt, ist dessen Auffassung, dass ein Menschenleben erst durch die Erfahrung von Extremsituationen tatsächlich gelebt wurde und nur so das Privileg der Erlangung einer gänzlichen Selbsterkenntnis möglich werde. Doch statt des Eintretens dieser romantisierten Vorstellung über den Ausnahmezustand des Krieges kommt es zur Überschreitung ethischer Normen. Das Streben nach Selbsterkenntnis wird zum Vorwand für die Suche nach dionysischem Rausch, was schließlich in moralischem Verfall und Wahn Hurds mündet.
Gleichwohl sich Hurd berufsbedingt des Schicksals von tragischen Helden, die sich auf den Weg in die Hölle begeben, durchaus bewusst ist, blendet er dies vollends aus und nimmt den Kassandraruf »Welcome to hell« seines Übersetzers blind und voller Erwartungen entgegen. Šurups Ausruf ist letztlich nichts anderes als eine Grußformel, die auf die Inschrift von Dantes Torbogen zur Hölle rekurriert: »Ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren.«
Die Beziehung zwischen Hurd und Šurup bildet die Rahmenhandlung des Romans, die mit der Bewunderung des Übersetzers für den Gelehrten beginnt und im weiteren Verlauf die Stadien von Abscheu bis hin zu Mitleid durchläuft. Während Hurd in Abwesenheit der Leser:innenschaft durch die Stadt streift, sodass zwar nie die Ereignisse, dafür aber sein sich zum Negativen entwickelnder physischer und psychischer Zustand durch die Erzählinstanz Rajko Šurup geschildert wird, porträtiert Šurup als Chronist in für sich stehenden Episoden die Menschen seines Umfelds. Dabei ist der Roman derart auf verschiedenen Ebenen miteinander verknüpft, dass man unweigerlich an einen Organismus denkt.
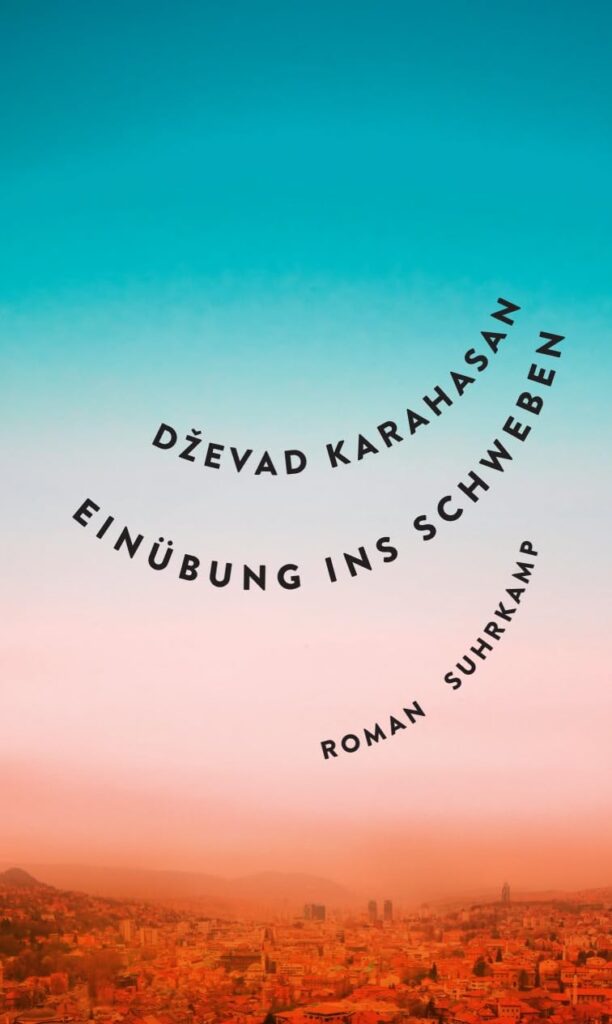
Einübung ins Schweben
Suhrkamp: 2023
304 Seiten, 25 €
Vom Kitt der Gesellschaft
Beschrieben wird der Zustand, in dem der Kitt einer Gesellschaft gänzlich aus den Fugen geraten ist und somit alles in der Schwebe zu sein scheint. Wenn der Stromausfall, der Bau eines provisorischen Trinkwasserbrunnens oder das Ausharren in Bunkern zum Alltag wird, beginnen sich die vormals intakten zwischenmenschlichen Verhaltensweisen zu verändern. Der Kern des Romans ist, was ihn gleichzeitig auszeichnet: die Dechiffrierung des Banalen. Denn diese Thematik ist nicht an einen temporal beschränkten Diskurs gebunden, sondern behält durch ihre Zeitlosigkeit stets ihre Aktualität bei.
»Meiner Erfahrung nach (…) ist Krieg in Wahrheit eine Zeit des entblößten Menschen.«
Šurup schildert, was der Schwebezustand, in dem sich die Individuen aufgrund der Belagerung der Stadt bewegen, mit ihnen macht, und verweist dabei auf die Polarität einer Gesellschaft im Ausnahmezustand. So halten beispielsweise die einen umso mehr die Konventionen des gesellschaftlichen Zusammenlebens hoch, während die anderen das genaue Gegenteil tun und sich dieser Regeln vollständig entledigen. Die Ursache für dieses gegensätzliche Handeln sieht Šurup in der Scham begründet, die wiederum einen wesentlichen Bestandteil des zivilisatorischen Firnisses ausmacht. Sie trägt in ihrer Funktion eines Regulators des eigenen Verhaltens zur Internalisierung sozialer Normen sowie Erwartungen bei und führt so zu einer Anpassung des eigenen Handelns. Im Ausnahmezustand wird jedoch nicht von allen innerhalb einer Gesellschaft von ihr Gebrauch gemacht, sondern stattdessen versucht, sich ihrer zu entledigen. Šurup exemplifiziert das Thema der Scham am Beispiel der tragischen Helden Achilles und Odysseus, die jeweils auf gegensätzliche Weise mit ihr umgehen. Achilles, der sich schämt, nachdem er die Leiche Hektors schändete; und Odysseus, der sich seiner Scham entledigen musste, um so die Lüge und den Betrug als Mittel zum Zweck auf seiner Irrfahrt zu nutzen. Was den Roman auszeichnet und vor allem charakteristisch für ihn ist, sind eben jene mäandernde Querverweise, die thematische Bögen zwischen dem Leben in der belagerten Stadt und der griechischen Antike spannen.
Die philosophischen Exkurse, auf die Karahasan die Leser:innenschaft einlädt, entschleunigen den Roman mit seiner Kriegsthematik. Sie sind eine Aufforderung, sich von seinen gefestigten Ansichten zu lösen und sich darauf einzulassen, den Standpunkt, der noch zuvor als richtig erschien, durch einen Standpunkt, der zuvor als falsch erachtet wurde, zu entkräften. Was bleibt ist die Erkenntnis, dass selbst das vermeintlich Klare und Erkennbare oftmals in der Schwebe zu finden ist.






