In Dream Count verleiht Chimamanda Ngozi Adichie vier Frauen eine Stimme, die ein vielschichtiges Bild von Freiheit, Schmerz und Verbundenheit entwerfen. Mit poetischer Präzision und unerschrockener Offenheit erschafft sie einen Roman, der Ambivalenzen aushält und das Ungewöhnliche im Alltäglichen zeigt.
Hinweis: Der folgende Text enthält Beschreibungen von sexualisierter Gewalt. Wenn Sie Unterstützung in diesem Bereich suchen, finden Sie in Göttingen unter anderem Hilfe bei dem Frauennotruf.
Von Marie Luise Böttcher
Bild: via Pexels, CCO
Nach zehn Jahren endlich einen neuen Roman von Chimamanda Ngozi Adichie lesen zu dürfen, ist ein Grund zur Freude. Anders als Americanah stellt Dream Count keine Liebesgeschichte ins Zentrum, sondern rückt vor allem weibliche Perspektiven in den Fokus. Vier Schwarze Frauen führen abwechselnd durch die Handlung, wobei sich ihre höchst unterschiedlichen Lebenswege berühren, aneinanderstoßen und einander spiegeln. Ihre Stimmen stehen gleichberechtigt nebeneinander – eine Erzählweise, die den Inhalt reflektiert.
Adichie beschreibt mit brutaler Ehrlichkeit, nutzt ungeschönte Worte, wo sie nötig sind, und webt gleichzeitig poetische, einprägsame Bilder in diesen klaren Ausdruck hinein. Ihre sprachliche Brillanz ist spürbar – etwa, wenn sich der Stil subtil an die jeweilige Hauptfigur anpasst: Kadiatous Stimme ist schlicht und sanft, während Omelogor präzise und hart urteilend auftritt. So entsteht kein Dokumentarbericht, sondern echte Sprachkunst, die den Inhalt des Romans unterstreicht und einen besonderen Lesegenuss garantiert.
Den Schmerz mit Stolz ertragen
Als Zikora in den Wehen liegt und vor Schmerzen schreit, zischt ihre Mutter: »Jikota onwe gi« – Nimm dich zusammen. Ihr wurde beigebracht, dass Schmerz ein Prüfstein für Frauen ist, der mit Stolz getragen werden muss. Und nach diesem Grundsatz versucht sie zu leben. Nach außen hin gibt sie sich als souveräne Anwältin, doch innerlich zehrt die Kluft zwischen ihren Erwartungen und ihrer Lebenswirklichkeit an ihren Kräften. Um das Bild einer »normalen« Familie zu retten, erniedrigt sie sich vor dem Vater ihres Kindes: Sie schreibt ihm täglich Nachrichten, die er ignoriert, wartet vergeblich vor seinem Hotel, und schickt ihm sogar noch aus dem Kreißsaal Fotos ihres Neugeborenen. Zikora schämt sich für jede Nachricht, jedes Foto, hält aber dennoch verzweifelt daran fest, als könnte ihre Beharrlichkeit seine Abwesenheit ungeschehen machen.
Auch Chiamaka, genannt Chia, kämpft für einen Platz in einer Liebe, die es nie gab. Die Reiseschriftstellerin sucht nach der außergewöhnlichen, überschwänglichen Liebe – ausgerechnet bei Darnell, dem stoischen Professor, der nur Bücher mit Doppelpunkt im Titel liest und eine Vorliebe dafür hat, Chia bloßzustellen. Beide Frauen verharren mit erzwungenem Lächeln in ihrem Schmerz, doch wie lange kann ein Mensch sich verleugnen? »Selfsabotage is not love«, sagt Adichie in einem Interview – eine Lektion, die beide Frauen schmerzvoll lernen müssen.
Denn die heilsamsten Bindungen entstehen in Dream Count oft jenseits von Romantik: in Sisterhood, in mütterlicher Fürsorge, in Freundschaft. Dabei sind diese Frauenbünde auch geprägt von Rivalität und Missverständnissen – umso eindrücklicher ist ihre radikale Bereitschaft, einander dennoch nicht fallen zu lassen. Es ist das Gefühl für ein gemeinsames weibliches Schicksal, das in Dream Count eine Brücke über sonst unüberwindbare Abgründe baut. Dies gilt insbesondere für die Mutter-Tochter-Beziehungen, die das Rückgrat des Romans bilden. Als Zikora von ihrer Schwangerschaft erzählt, rechnet sie mit den unerbittlichen Vorwürfen ihrer Mutter, deren Ziel sie so häufig ist. Sie ist auf alles vorbereitet, nur nicht darauf, dass ihre Mutter schlicht fragt: »Wann ist dein Geburtstermin, damit ich anfangen kann, Vorbereitungen zu treffen?«. Zikora und ihre Mutter lernen gemeinsam, was gewonnen werden kann, wenn sich Mutter und Tochter gegenseitig als Frauen in der Welt erkennen.
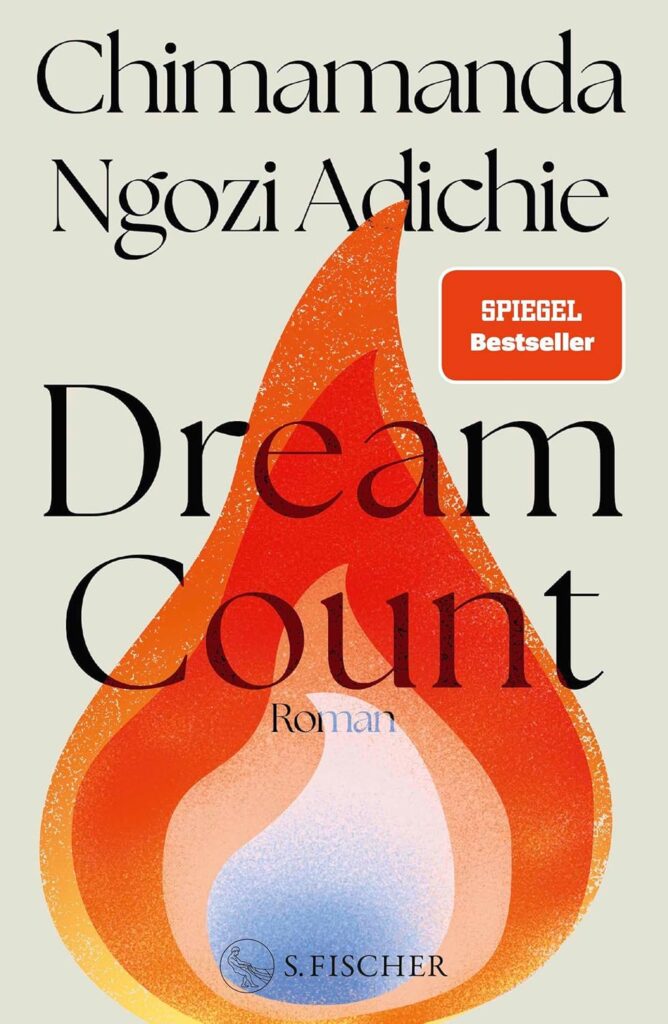
Dream Count
S. Fischer: 2025
528 Seiten, 28 €
Freiheit im Gegenlicht
Während sich Zikora und Chia nach Liebe und Zweisamkeit sehnen, verteidigt Chias Cousine Omelogor ihre Freiheit gegen jede Form von Nähe. Dabei »erregt [sie] starke Gefühle – Bewunderung und Abneigung, Neid und Hingabe – aber niemals totenstille Gleichgültigkeit«. Als Top-Bankerin lebt sie in Nigeria kompromisslose Selbstbestimmung: unverheiratet, kinderlos, unantastbar. Omelogor ist nicht das Gegenmodell zu den anderen Frauen, sondern eine Zuspitzung derselben Frage: Wie frei kann, und will, eine Frau sein?
Dabei hat sie sich ihre Position auch mit schmutzigen Mitteln erkämpft. Sie beteiligt sich an Korruption, wäscht Geld, verbrüdert sich mit der Machtelite des Landes. Was als Rausch begann, wird ihr zunehmend zur Last. Konfrontiert mit einer Sinnkrise, die ein enttäuschender Studienaufenthalt in Amerika noch verstärkt, muss sie allein über den Einsatz ihrer Macht entscheiden.
Ganz anders ergeht es Kadiatou, Chias Haushälterin. Ihre Geschichte ist geprägt von struktureller Ohnmacht. In Guinea wuchs sie still im Schatten ihrer rebellischen Schwester auf, die es »unter der Unrast ungeschlüpfter Träume« kaum aushielt. Kadiatous eigene Träume von Sicherheit und Stabilität sind bescheidener und scheinen sich in Amerika endlich zu erfüllen. Bis ein VIP-Gast sie bei ihrer Arbeit in einem Hotel vergewaltigt.
Ein geschützter Winkel der Welt
Auf Drängen ihrer Vorgesetzten bringt Kadiatou den Fall zur Anzeige – unterzieht sich Untersuchungen, bei denen selbst ihr Mund zum Tatort erklärt wird. Doch bei einer medialen Hetzjagd zieht sich die Schlinge um ihren Hals zu, nicht um den des Täters. Die Worte wirbeln in ihrem Kopf: Hochstaplerin, Prostituierte. Ihre kleine Wohnung, Symbol des hart erkämpften Friedens, wird von Journalist:innen belagert und ein Ort der Angst.
Adichie verarbeitet in Kadiatous Geschichte die realen Berichte von Nafissatou Diallo und zwingt ihre Leser:innen zur Introspektion: Geht es hier wirklich um Gerechtigkeit? Kadiatou selbst sehnt sich nicht nach Vergeltung oder Entschädigung, sondern nur nach dem Trost ihrer Küche:
»Sie dachte daran, wie sie vor gar nicht langer Zeit an ihrem freien Tag in der Küche urplötzlich von Zufriedenheit durchströmt worden war, von ruhigen, erfrischenden Schüben reinster Zufriedenheit, während sie am Spülbecken stand, Maismehl siebte, Trockenfisch zerbrach und zusah, wie eine ganze Chilischote im Topf dümpelte und Schärfe und Geschmack abgab.«
Wenn Omelogor ihr spöttisch entgegnet: »Sei doch nicht so dankbar«, hallt es auch in den Lesenden nach. Unwillkürlich wird man auf sich selbst zurückgeworfen. Wofür ist man selbst dankbar – und wofür sollte man es vielleicht sein?
Das tägliche Menschsein
Dream Count erzählt von fehlerhaften Menschen, deren Leben keine »endlose Prozession der Tugendhaftigkeit« ist. Es wäre leicht – und nachvollziehbar –, marginalisierte Figuren als moralisch einwandfrei zu inszenieren: zur Inspiration für die einen, zur Lektion für die anderen. Doch das ist nicht Adichies Anliegen. Chia, Zikora, Kadiatou und Omelogor sind Frauen. Sie sind Schwarz – und beides prägt, wie sie leben und wie auf sie reagiert wird. Doch auch sie können existieren, ohne repräsentieren zu müssen. Dies trifft auf die Nebenfiguren ebenfalls zu. So ist Omelogors Freund Jide etwa kein inspirierender Held, der vorbildhaft seine Identität gegen die Homophobie seines Umfelds verteidigt. Er verharrt in Passivität und maskiert mit Zynismus seine eigene Mutlosigkeit. Keine Katharsis, kein moralischer Appell.
Der Roman gibt Einblicke in komplexe Lebensrealitäten: Ekel beim Sex, Flucht in Unterwerfung, Tränen im falschen Moment, aber auch Trost über Zoom-Sessions und mysteriöse Fremde, die einen in London zu einer Tasse Earl Grey einladen. Das alles ist ungewöhnlich – und gleichzeitig ist es das nicht. Wie Zikora es auf die Frage nach ihrer Mutter ausdrückt: »Sie ist ungewöhnlich, aber normal.« Dann korrigiert sie sich: »Ungewöhnlich und normal.« Dream Count nimmt einen nicht immer sanft bei der Hand, reißt sie einem aber auch nicht aus. Wer diese Offenheit aushält, kann einen neuen Blick gewinnen – auf das eigene Innenleben wie auf das anderer. In jedem Fall gilt: »Kleinkram ist es nur für kleine Geister«.






