Wie entsteht ein Gedicht? Man schlage Frieda Paris‘ Nachwasser auf und schaue ihm beim Wachsen zu. Ein Debütband, der Zeit braucht, bis man sich an seinen Sound gewöhnt hat. Dann aber entfaltet das Langgedicht eine Perspektive auf Sprache und Wahrnehmung mit dem Potenzial, diese nachhaltig zu formen.
Von Sophie-Marie Ahnefeld
Eine lose Blättersammlung, darunter Einkaufslisten, Randnotizen, Unvollendetes. Eine junge Dichterin sitzt vor ihnen, durchblättert das Geschriebene, inhaliert die Wörter, verflicht ihre eigenen mit fremden. Auf ihrer Schulter sitzt ein Vogel, zu dem sie spricht, »der schnabelnd Fragen stellt und selten nur in Ruhe lässt.« Es ist der Nachlass der großen Friederike Mayröcker, den die Dichterin Frieda Paris in sich aufnimmt, in die eigenen literarischen Staubecken einfließen und durch eigene Wortturbinen laufen lässt. In 111 Texten spinnt Paris aus dem Stoff, aus dem Mayröckers, Jandls, Celans und Gedichte weiterer Autor:innen sind, ihr eigenes Langgedicht: Nachwasser.
Die Sonde, die »Wortmutter«
Schreiben übers Schreiben? Nicht schon wieder, meint Paris ihre Leser:innen stöhnen zu hören, und doch müsse es sein: »ich schließe das Schreiben nie aus, beziehe es ein, / stehe in Beziehung zu meinem Schreiben, ihm gegenüber / wie mich umgebenden Personen«. Wie eine Sonde umkreist sie ihre »Wortmutter« Friederike Mayröcker, die sich auch stilistisch im Text wiederfindet. Die einfließenden Zitate – stets durch eingeklammerte Autor:innennamen gekennzeichnet – wechseln dabei ihre:n Besitzer:in, verlieren durch die eigenwillige formale Gestaltung und in ihrer Auffädelung neben neuen Wörtern ihren Fremdheitscharakter. Paris lässt das Nachdenken über Kindheit und Sprache, Vogelsymbolik, Literaturreferenzen und tagebuchartige Beobachtungen über das, was man alltäglich nennen möchte – Mayröckers Einkaufslisten, eine Zeitungsüberschrift über den Ukrainekrieg –, wie Hologramme aufleuchten, die durch das Zusammenfallen der verschiedenen Lichtpunkte ein dynamisches Gebilde erschaffen.
»als Kind haben mich meine Eltern Elster genannt
was glänzte, musste ich eine Weile für mich
haben oder halten, ins Licht«
Den dringlichen Wunsch, das Schöne wie eine Elster ergreifen zu wollen, es für sich zu besitzen und anderen zu zeigen, äußert Paris bereits in diesem ersten Text und stellt damit ihr poetologisches Konzept einerseits vor – andererseits aber auch in Frage. Sichtlich bemüht, »Verallgemeinerungen zu vermeiden« ist der Text Zeugnis des Ringens um eine eigene Sprache, um eine Stimme im Chor des lyrischen Kanons. Ein mögliches Scheitern des Vorhabens wird immer gleich mitgedacht. Fehler, Ungenauigkeiten und Verbesserungen werden stehengelassen und damit semantisch aufgeladen, ganz wie die umgeknickten Seiten, die wechselnden Stifte und Wortfetzen und Fragmente aus dem Mayröcker-Nachlass. In die Reihe der großen Fragen schreibt Paris ihre eigene hinein, die spürbar über dem Gesamttext schwebt: »Was darf ein Gedicht?«
Zwischen Archivpflege und tastendem Sprachneubasteln
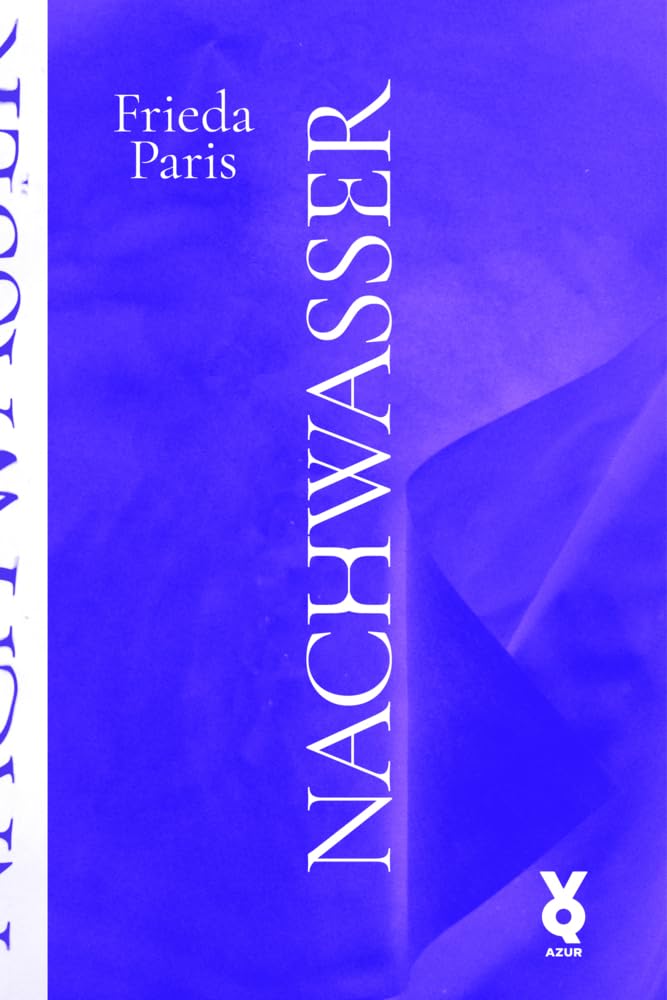
Nachwasser
edition AZUR: 2024
136 Seiten, 22 €
Darauf eine Antwort zu geben, überlässt Paris ihren Lesenden und reicht uns Nachwasser an die Hand, zeigend, was ein Langgedicht sein kann. Der Band ist keine Textansammlung, die man irgendwo in der Mitte aufschlagen und nur zwei, drei Seiten lesen könnte. Vielmehr ist es ein Schwung, ein kontinuierliches Schreiben, dessen Sound irgendwo zwischen Archivpflege und einem tastenden Sprachneubasteln am Schneidetisch Gewöhnung braucht. Auch fordert Nachwasser seinen Lesenden ab, die elliptischen Passagen mithilfe der eigenen Fantasie auszufüllen. Mayröcker zu lesen, empfiehlt sich zur Vorkenntnis – und allgemein – unbedingt.
Kursivierungen, Großschreibung, Aussparen von Punkten, visuelle Poesie, Listen, prosaische Abschnitte – ein Austesten des Schreibbaren zieht sich durch den aus 111 Texten bestehenden stream of consciousness, in welchem sie auch ihre Quellen, Danksagungen und ihren Schreibzeitraum als Montage einbaut: »Wien, Juli 2022 – Oktober 2023« (auch dieser 111. Text steht ohne Punkt da). Wenn gleich literarisches Debüt, ist ihr Ton selbstsicher und klanglich fließend. Er zeugt von einer langjährigen Schreibroutine, die ihren Veröffentlichungen in Anthologien und auch dem ebenfalls Mayröcker gewidmeten Hörspiel HERZBEFELLT, ein Nachrufen (DLF Kultur 2022) entspringt. Mit bürgerlichem Namen heißt die Wahlösterreicherin übrigens Friederike Schempp – auch den Vornamen teilt sie sich mit ihrer »Wortmutter«.
Viele Fragen bleiben am Ende ungelöst: Was also ist das »Nachwasser«? Was darf denn ein Gedicht nun? Und überhaupt, kann ein Langgedicht wie dieses jemals zu Ende geführt werden? Ist es nicht vielmehr Sinnbild für ein poetisches Wahrnehmen und Fühlen, in das die Autorin uns für den Zeitraum von Juli 2022 bis Oktober 2023 hineinlinsen lässt? Es ist kein einfacher, kein sofort greifbarer Text. Einheit, Geschlossenheit, Formvollendung – all das hat Nachwasser im klassischen Sinne nicht. Jedoch liegt genau darin seine Stärke: Wie ohne einen einzigen Atemzug auskommend und doch mit sattem Stimmklang, ohne große Versprechungen, aber viel Ermutigung, weniger Rausch, sondern eher vielstimmiges Raunen eines beständigen Stromes. Frieda Paris leiht uns für den Moment des Lesens ihre Augen, die über den Schneidetisch von Erinnerungsfetzen und Textfragmenten gleiten. Auch nach Beendigung der Lektüre hallen ihre Worte nach: »Wie kommen wir je wieder aus dem Gedicht?«






