In Das Ende ist beruhigend entwirft Carla Kaspari in klarer, nüchterner Sprache das Bild einer Utopie, die ihre volle Wirkung erst durch ihre Verortung im Zentrum einer Dystopie entfaltet. Die Handlung spielt im Italien des Jahres 2130. Unter einer Kuppel herrschen paradiesische Zustände – während im ›Außen‹ die Klimakatastrophe unaufhaltsam voranschreitet.
Von Lara Müller
Bild: via Pixabay, CC0
Die Sonne verbrennt die Haut und feiner Staub verschmutzt die Luft. Ein Großteil der Erde ist nicht länger bewohnbar. Das seltenste Gut in dieser Apokalypse? Die Hoffnung. Und davon gibt es im Dorf der Protagonistin Esther mehr als genug. Denn: Esther und ihre beste Freundin Théa leben im Paradies auf Erden. Unter einer Kuppel gehen sie in ihrem Dorf allem nach, was das Herz begehrt: Kunst, Kultur und Yogakursen.
Entsprechend der Ambivalenz des guten Lebens inmitten einer drohenden Katastrophe durchbricht die Autorin die Perspektive ihrer Protagonistin Esther mit Zwischenkapiteln, die sich dem Berliner Oligarchen Dean widmen. Dean weiß im Gegensatz zu Esther um den bevorstehenden Weltuntergang; er navigiert durch die apokalyptische Großstadt mit einer gewissen Aura von Selbstverständlichkeit. So schlendert er fast bedenkenlos durch die Stadtwüste, entscheidet ohne großes Grübeln, ob er einen Sonnenschutz braucht und nimmt nebenbei noch einen Zug der Hoffnungsdroge. Dabei balanciert er auf dem schmalen Grat zwischen Philanthropie und Egomanie: »Dean war schon immer anfällig für Stimmungen und Atmosphären, deswegen setzt ihm der Fatalismus, der da draußen herrscht, zu, oder zumindest bereitet es ihm schlechte Laune all diese schwachen Menschen zu sehen, die augenscheinlich aufgegeben haben.«
Die Erzählperspektive wechselt mit Esthers und Deans Kapiteln jeweils zwischen einer Ich- und einer personalen Erzählsituation. Zusätzlich schildern die Newsletter von Esthers bester Freundin Théa – in einer anderen Schriftart vom übrigen Text abgesetzt – immer wieder die klimatische Lage sowohl im Dorf als auch im ›Außen‹. Die Einschübe stellen einen weiteren Modus der Narration dar, der das Lesen trotz der nüchternen Ausdrucksweise der Autorin abwechslungsreich gestaltet. Zu dieser Wirkung trägt auch die Schreibart Kasparis bei, die Emotionen und Gedanken ihrer Figuren zu beschreiben, ohne sie zu explizieren und damit zu disambiguieren. Selbst das Handeln der Protagonistin Esther bleibt damit oft – und im besten Sinne! – unerklärt.
»Ich wiege meinen Körper vor und zurück. Mein Geist ist so offen und weit, mein Bewusstsein fühlt sich endlos an, so endlos wie ein wolkenfreier Himmel. Alles ergibt Sinn. Vor und zurück. Eine meiner Sonnen geht am wolkenfreien Himmel auf. Vor und zurück. Nichts ergibt Sinn.«
Der Realismus der Antiheldin
Kaspari entwirft mit Esther eine Hauptfigur, die nicht unbedingt sympathisch, dafür aber realistisch wirkt. Sie ist gerade keine Heldin, die die Welt retten will. Viele ihrer Gedanken wirken wie Spitzen auf unsere Gegenwart, etwa wenn sie sich mit der aktuellen Kritik zum Konzept der Remote-Dörfer befasst, auf welchem das Kuppel-Dorf basiert. Schließlich kommt Esther zum Schluss, diese Kritik sei »hohl« und nur aus »der Lust am Kritisieren« geäußert worden. Die Protagonistin scheint sich auch mit einer Gehirnwäsche, der sie sich wissentlich und freiwillig vor ihrem Einzug in das Dorf unterworfen hat, sehr wohlzufühlen. Als Esther für eine Ausstellung ihrer Kunst das ›Außen‹ besucht, stellt sie fest:
»Ich will mir nicht vorstellen, was der Zustand der Außenwelt mit mir machen würde, wenn wir vor der Ausreise keine Anwendung bekommen hätten. Ich nehme zwar wahr, wie schlimm es ist, aber das bittere Gefühl des Endes und der absoluten Hoffnungslosigkeit dringt nicht ganz durch. Es ist, als wäre mein Bewusstsein durch eine dünne, aber effiziente Hülle geschützt.«
Hoffnung oder Akzeptanz?
Mit der Zeit und den Bemühungen ihrer besten Freundin werden schließlich auch Esther die Augen geöffnet – und das gegen ihren Willen und (fast) ohne ihr Zutun. Stück für Stück kommt sie hinter den geheimen Grund, aus dem die Superreichen die Kuppeldörfer ins Leben gerufen haben. Wird sie sich den Anti-Dorf-Aktivist:innen anschließen, die von ihrer Freundin Théa angeführt werden, oder doch in die Sicherheit der Kuppel zurückkehren? Und gibt es in dem grauen Zukunftsbild, das Kaspari entwirft, überhaupt noch richtige und falsche Antworten?
Als wären diese Fragen für Esther nicht schon kompliziert genug, drehen sich mit der Zeit auch immer mehr ihrer Gedanken um Thomas. Thomas, der gegen Hoffnung immun ist, Thomas, der mit seiner Ehefrau Cleo in das Dorf eingeladen wird, um dort seiner Tätigkeit als Schriftsteller nachzugehen. Auch er ist nicht das, was er zu sein vorgibt. Jede Figur in Das Ende ist beruhigend besticht schließlich durch ihre Dreidimensionalität; es gibt keine Held:innen und auch keine Bösewichte.
Viel gesagt und nichts gemeint?
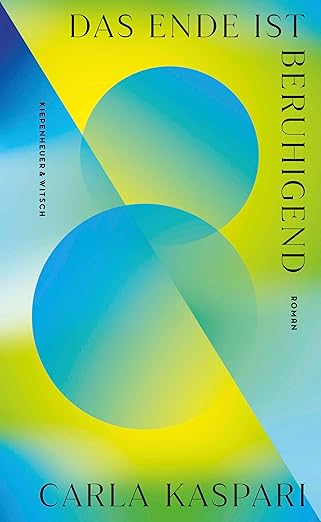
Das Ende ist beruhigend
Kiepenheuer&Witsch: 2025
272 Seiten, 22 €
Kaspari öffnet wie eine Universalgelehrte unterschiedliche Dimensionen des futuristischen Gesellschaftslebens, imaginiert etwa kommende wissenschaftliche ›turns‹ und setzt sich mit einem möglichen Kunstbegriff der Zukunft auseinander. Obwohl sich der Roman vor allem mit den Auswirkungen der Klimakatastrophe beschäftigt, entsteht wie nebenbei das dichte Panorama einer Zukunft, das die Probleme und Chancen unserer heutigen Gesellschaft weiterdenkt: Die Auswirkungen von artifizieller Intelligenz auf die bildenden Künste werden dabei genauso angeschnitten wie Algorithmen, die besser zu wissen scheinen als die Nutzer:innen selbst, welche Medien und Inhalte diese konsumieren wollen. Dabei wirkt Tetra, das Handy von morgen als kleine Uhr am Handgelenk, nicht wie ein Fremdkörper, den die Autorin in besonderer Weise zu inszenieren sucht, sondern vielmehr wie ein organischer Teil des fiktiven Universums, dessen Existenz keine weitere Erklärung benötigt. Selbst die Hoffnungsdroge, die Dean ins Leben gerufen hat und die fleißig weiterentwickelt wird, existiert wie selbstverständlich neben normalen Zigaretten.
Von all diesen Facetten der letalen Zukunft, die Das Ende ist beruhigend auf bloß etwas mehr als 250 Seiten entwirft, wird allerdings kaum eine vollständig ausgemalt. Bei allen behandelten Gegenständen wie neuartigen Drogen, Hypnosen und Technologien handelt es sich zwar um spannende Denkanstöße, diese können sich jedoch nie ganz entfalten. So wird weder die genaue Funktionsweise von Esthers Gehirnwäsche noch die der Hoffnungsdroge jemals erklärt. Daher ist die Kulisse des Romans zwar vielversprechend, aber ihr Potential wird nie ausgeschöpft – tiefgehenden Weltenbau, den man aus anderen Zukunftsromanen wie Tribute von Panem gewöhnt ist, sucht man hier vergeblich.
Zeitvertreib mit Inhalt
Das Ende ist beruhigend besticht vor allem durch seine Relevanz. Die Frage, wie der Großteil der Menschheit nach dem Point of no Return mit seiner todgeweihten Existenz weiter verfahren soll, stellt ein nicht mehr allzu weit entferntes Dilemma unserer Gesellschaft dar. Obwohl das fiktive Universum des Romans tiefgehender hätte ausgearbeitet werden können, sind die zentralen Motive Freundschaft, Hoffnung und Liebe im Angesicht der Apokalypse einnehmend genug, dass sich die Seiten fast von selbst umblättern. Und so viel ist vorwegzunehmen: ›Beruhigt‹ ist man in Anbetracht des herannahenden Weltuntergangs nach der Lektüre noch lange nicht.






