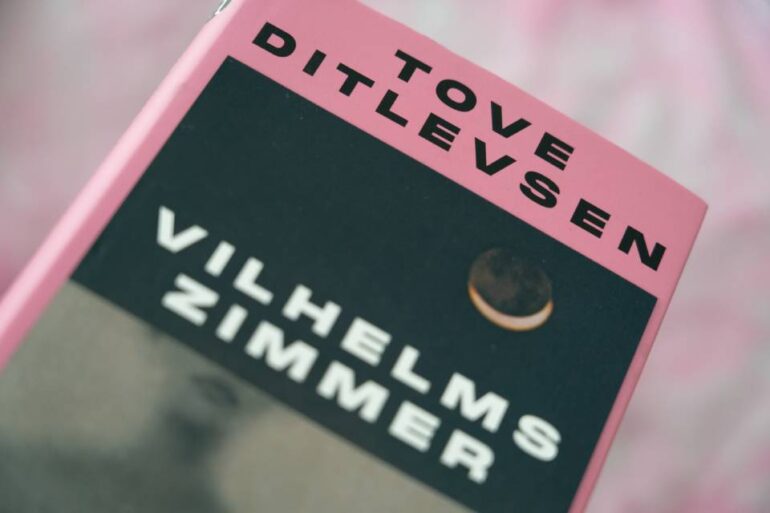Tove Ditlevsen ist in Dänemark Teil des Kanons. Internationaler Ruhm wurde ihr aber erst in den letzten Jahren zuteil. Vor allem um ihre »Kopenhagen-Trilogie« entstand ein regelrechter Hype. Ditlevsens letzter Roman, Vilhelms Zimmer, zeugt einmal mehr von ihrer literarischen Brillanz.
Von Jakob Malzahn
Bild: John C. Beuck
Tove Ditlevsen wurde 1917 geboren; als Arbeiterkind wuchs sie in ärmsten Verhältnissen auf, machte dennoch als Schriftstellerin Karriere und nahm sich 1976, nach zahlreichen gescheiterten Ehen und mindestens ebenso zahlreichen literarischen Meisterwerken, das Leben. Mehr sei an dieser Stelle nicht zur Person gesagt, Vilhelms Zimmer (1975) ist ohnehin stark autobiographisch angelegt. In diesem letzten Roman hat Ditlevsen nochmal alle Register gezogen: Zentrales Thema ist das Scheitern der katastrophalen Ehe zwischen der Autorin Lise und dem Zeitungsinhaber Vilhelm. Es geht um Alkoholexzesse, Psychiatrieaufenthalte, Kindheitstraumata, körperliche und geistige Verwahrlosung, Suizidgedanken. Der Roman ist eine einzige Trigger-Warnung. Weil die Schilderungen des Schmerzes und Kontrollverlustes von Formbewusstsein und blitzgescheiter Komik durchdrungen sind, liest man den Roman dennoch mit großem Vergnügen.
Eine wahnsinnige Beziehung
»Aber Vilhelms und meine Liebe ist so, dass einer von uns beiden jetzt sterben muss« – die Ehe der beiden Intellektuellen als toxisch zu bezeichnen, wäre eine grobe Verfälschung; sie ist nicht toxisch, sie ist ein Selbstzerstörungsakt. Es wird kein »poison paradise« besungen, sondern die reine Ehe-Hölle. Hat Vilhelm Lise zu Beginn noch aus einer Tablettensucht befreit, entwickelt er sich nach ihrem erfolgreichen Entzug selbst zum Nervenbündel, wenn nicht gar zum »charmanten Psychopathen«. So zumindest wird er von Lises Psychoanalytiker ferndiagnostiziert. Es gibt keinen Ausweg aus der Spirale gegenseitiger Einschüchterung und Demütigung. »Wenn ich jemandem wirklich weh tue, verzeihe ich ihm das nie!«, gesteht Vilhelm.
Dass Lise und Vilhelm ein Paar geworden sind, ist aber kein Missverständnis, sondern liegt in ihrer charakterlichen Verfassung, ihrer gegenseitigen Bewunderung und Konkurrenz sowie der gemeinsamen Prägung durch bittere Armut begründet. Die Intervention anderer kann nicht gelingen, weil diese gar nicht fähig sind, ein Verständnis für die Triebfedern der verhängnisvollen gegenseitigen Anziehung aufzubringen. Über die Freundin Mille, die zeitweise versucht, die beiden voreinander zu retten, heißt es: »Ihre Bösartigkeit besteht darin, dass sie unglückliche Menschen nicht sehen kann, ohne unermüdlich daran zu arbeiten, sie glücklich zu machen.«
Große Stilistin
Bereits die Grundkonstellation zeugt von einem wahnwitzigen Spiel mit narrativen Regeln: Die Erzählerin ist einerseits oft deckungsgleich mit Lise und berichtet andererseits – nun nicht mehr identisch mit Lise – aus dem Jenseits; von dort verfolgt sie das Ziel, ihre Hauptfigur Lise bald loszuwerden. In der Mitte des Romans schreibt die Erzählerin, sie müsse Lise »mit einer neuen Sprache beschenken, nach deren Kühnheit Vilhelm nicht mehr vergebens suchen würde.« Dies gelingt ihr vollauf. Die Verwerfungen, Gemeinheiten und Selbstzerstörungsexzesse werden den Leser:innen mittels formvollendeter Sätze wie auf einem Silbertablett präsentiert.
Apropos ,wie‘: Ditlevsen verwendet gerne das von Gottfried Benn verpönte Stilmittel des wie-Vergleiches. Hier zeigt sich geradezu paradigmatisch, dass große Stilisten nicht durch Einhaltung aller Stilregeln, sondern durch deren gekonnte Missachtung ihre Größe unter Beweis stellen. Beispielsweise wird die groteske Figur Kurt – nun eröffnet die Erzählerin wieder die Metaebene – mit folgendem großartigen wie-Vergleich aus dem Roman verabschiedet: „Er hat seinen Zweck in diesem Buch erfüllt und fällt jetzt zwischen den Seiten heraus wie ein getrockneter Veilchenstrauß ohne Farbe und Geruch.«
Lust am Text
Von Realismus und Leser:innenführung will dieser Roman nichts wissen. »Ich will jetzt nur noch erzählen, wozu ich Lust habe«, äußert die Erzählerin. Der Roman ist eine Montage aus Zeitungsausschnitten, Briefen, zahlreichen Rückblenden und surrealistisch anmutenden Erzählsträngen. Er enthält eine Genre-Parodie und behandelt ein großes Figurenpersonal, das teilweise nur lose miteinander verknüpft ist. Die hexenartige Frau Thomsen, die ein Stockwerk über Lise lebt, ist lediglich »ein Zipfel meines aufgelösten Bewusstseins«. Dies erklärt nicht nur viel über den Zustand der Erzählerin, sondern auch über die Erzählweise des Romans. Ständig wird der Fokus gewechselt, die Übergänge sind fließend.
Man könnte meinen, die Erzählerin habe ihre Figuren und Erzählstränge nicht mehr beisammen, aber dieser Eindruck täuscht. Zwar spielt sie nicht in der Manier der Realisten Gott, ähnelt dann aber doch dem Gott, den sie selbst anklagt. Dieser müsse »all seinen lustigen oder gemeinen Einfällen nachgeben, um dort oben im Himmel nicht vor Langeweile zu vergehen.« Auch die Erzählerin verfolgt konsequent ihre lustigen und gemeinen Einfälle. Mehrfach weist sie darauf hin, dass Frau Thomsen eine reine Erfindung sei und muss dennoch feststellen: »ihre Hässlichkeit war derart vollkommen, dass sie mir eine Art schaudernden Respekt abverlangte.« Aufgrund des unklaren ontologischen Status von Frau Thomsen, erspart die Erzählerin ihr den Tod, unterstreicht aber: »…falls es solche Existenzen wie sie überhaupt gibt, hat Gott einen gewaltsamen und plötzlichen Tod für sie vorgesehen.«
Autofiktion avant la lettre
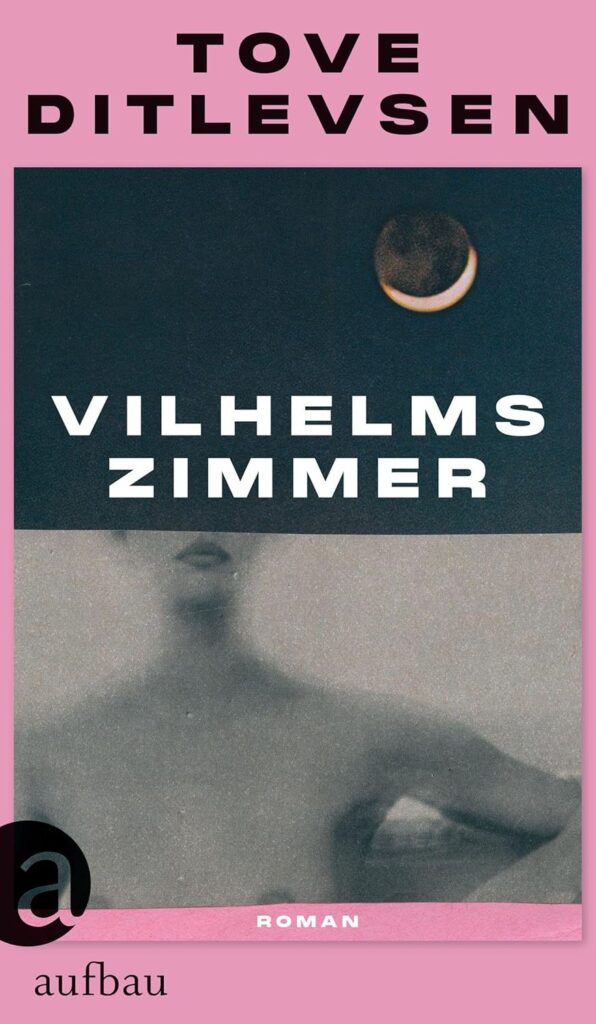
Vilhems Zimmer
Aufbau Verlag: 2024
206 Seiten, 22 €
Zeitgleich zum Ditlevsen-Hype gab es bei Leser:innen ein großes Interesse an autobiographischer und autofiktionaler Literatur. Ditlevsen zeigt, auf welchem Niveau sich diese Art Literatur abspielen kann. Noch bevor der Begriff der Autofiktion aufkam – das geschah nämlich erst ein Jahr nach Ditlevsens Tod – führt Ditlevsen vor, was den meisten aktuellen Autor:innen autobiographischer und autofiktionaler Literatur nicht gelingt: Trotz aller Grausamkeit und Tragik hat dieser Roman nichts gemein mit Bekenntnis- und Betroffenheitsliteratur. Stattdessen verwertet Ditlevsen das Material, das ihr das Leben in Überfülle geboten hat, aus rein künstlerischen Gesichtspunkten.
Die öffentliche Ausschlachtung einer Ehe zweier Prominenter – nichts weniger ist dieser Roman – wird ironisch gebrochen, indem Lise sich von Boulevard-Zeitungen interviewen lässt und die Geschichten aus der Ehe-Hölle zu einem beträchtlichen Budget in entlarvenden Artikeln zum Besten gibt. Vilhelm wiederum, um noch einmal auf die Einzigartigkeit der Beziehung zurückzukommen, argwöhnt beim Lesen ihrer Artikel lediglich, dass Lise sich unter Wert an dessen Konkurrenzblatt verkauft habe.
Unendlicher Spaß?
»Es führt von der Poesie kein direkter Weg ins Leben, aus dem Leben keiner in die Poesie.« Hofmannthals Diktum gilt in hohem Maße auch bei Ditlevsen. Für Menschen, die eine allzu eindeutige Übertragung des fiktiven Gehalts auf die Wirklichkeit forcieren, hat die Erzählerin nur Spott übrig. Aber was für einen Spott! John, eine Nebenfigur, rächt sich an Lise dafür, dass er angeblich als Vorbild für eine Figur in ihrem Kinderbuch hergehalten habe:
»John gönnte Lise diesen Schmerz aus vollem Herzen, weil sie einen ihrer Kinderbuchschurken nach seinem Vorbild gestaltet hatte. Es wäre vielleicht noch zu verkraften gewesen, dass sie den Gauner mit einem fliehenden Kinn ausgestattet hatte, aber dass er noch dazu meisterhaft Schach spielte [sic!] war zu deutlich gewesen.«
Die Erzählerin erwähnt einmal, Lise und ihr Sohn hätten die »Fähigkeit, aus wahnsinnigen Situationen Vergnügen zu ziehen«. Besser kann man Ditlevsens Leistung gar nicht beschreiben. Am Ende wird die Erzählerin selbst aus dem Roman entlassen. Ob sich hinter diesem letzten Kunstgriff noch bitterböse Ironie verbirgt oder bereits unverhohlene Tragik, lässt sich kaum mehr beurteilen. Eva Menasse sagte im Literarischen Quartett: »Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, ist, warum sie sich am Schluss umbringt, […] eigentlich hätte sie bis ans Ende ihrer Tage lachen sollen, nachdem sie das geschrieben hat.«