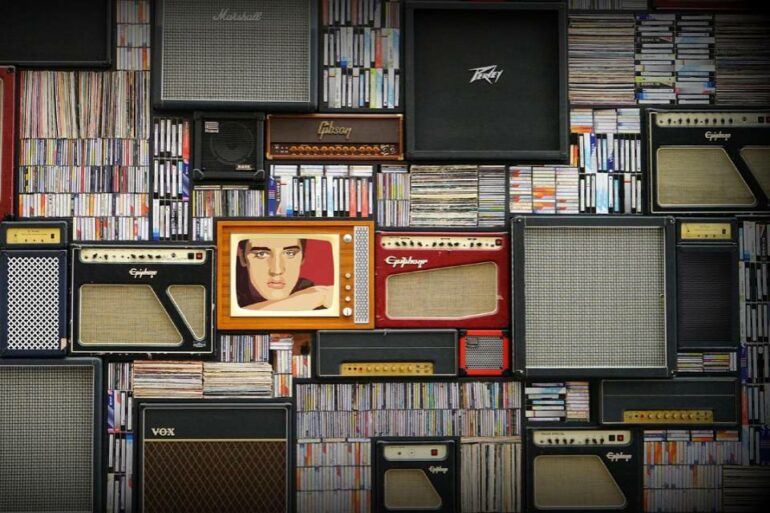Elvis Presley, Gospel, Gesellschaftskritik – zum Auftakt der Vorlesungsreihe 11 Lieder analysiert Heinrich Detering den Song If I Can Dream und zeigt, wie ein Popsong zum Spiegel eines zerrissenen Amerikas und zu einem kraftvollen Statement werden kann – zwischen Pop, Protest, Predigt und kultureller Erinnerung.
Von Sofia Peslis
Bild: Via Pixabay (cropped), CC0
In einem Hörsaal, der natürlich eher an Uni-Alltag als an Bühnenlicht erinnert, beginnt am Montagabend, den 28. April 2025, die neue öffentliche Vorlesungsreihe 11 Lieder – Relektüren und Analysen populärer Songs. Der Raum ist gut gefüllt, die Atmosphäre ruhig und erwartungsvoll, als Heinrich Detering – emeritierter Professor für Neuere deutsche Literatur und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Göttingen –, nach einer Begrüßung von Gerhard Kaiser das Mikrofon in die Hand nimmt. Der erste Song der Reihe ist If I Can Dream – und mit ihm kehrt nicht nur die Stimme von Elvis Presley in den Raum zurück, sondern auch die Frage, was Musik mit Hoffnung, Protest und Spiritualität zu tun hat. Detering führt die Zuhörenden konzentriert durch den Abend. Dabei spricht er nicht ausschließlich über diesen einen Song, sondern zeichnet die Linien nach, die von Elvis’ Stimme zu Fragen nach Identität, künstlerischer Selbstbehauptung und schließlich zum Gospel führen.
Zwischen Show und Statement
Detering beginnt die Vorlesung mit einem Musikvideo: If I Can Dream, Elvis im weißen Anzug. Die Szene stammt aus dem Comeback Special von 1968 – reduziert inszeniert, klar ausgeleuchtet, farblich dominiert von Schwarz, Rot und Weiß. Ein Mann allein mit seiner Stimme. Der Song, gedacht als kritischer Abschluss eines amerikanischen Weihnachts-Specials, wird bei Detering zur politischen Stellungnahme. Elvis’ Interpretation, so Detering, trage die Spuren eines Landes im Umbruch. Die Hoffnung auf Veränderung, aber auch die Müdigkeit angesichts der Gewalt.
Dass dieser Song in direkter Reaktion auf die Ermordungen des Aktivisten Martin Luther Kings und des Politikers Robert Kennedys entstand, ist bekannt. Doch Detering nutzt diesen Rahmen nicht für Pathos, sondern für Analyse. Er zeigt, wie eng die Inszenierung des Songs mit Fragen von Sichtbarkeit, Protest und künstlerischer Eigenständigkeit verbunden ist. If I Can Dream sei kein bloßes Denkmal, sondern Teil eines sorgfältig gestalteten Konzepts, das sich über Farben, Bewegungen und Kameraperspektiven ausdrücke.
Die Rückgriffe auf Gospel und Soul, auf Performance-Elemente afroamerikanischer Musiktradition, seien dabei nicht nur musikalische Mittel – sie würden auf eine Geschichte verweisen, in die sich Elvis einschreibt, bewusst oder unbewusst. Detering arbeitet diese Einschreibung mit feinem Gespür heraus, ohne sie zu glorifizieren oder zu verurteilen. Stattdessen geht es ihm darum, wie Popmusik Bedeutung schafft: durch Auswahl, durch Wiederholung, durch Kontext. Und in diesem Fall: durch ein Lied, das mehr sein will als Unterhaltung.
Weißer Sänger im schwarzen Sound
Wie wurde aus einem Jungen aus Tupelo, Mississippi, der berühmteste Interpret afroamerikanischer Musiktraditionen wie Blues und Rock? Die Stile entwickeln sich im frühen 20. Jahrhundert in afroamerikanischen Gemeinden im Süden der USA, oft aus mündlichen Traditionen, spirituellen Liedern und Arbeitsgesängen. Dass Elvis diese Musik einem breiten weißen Publikum zugänglich machte, gehört zu den spannungsreichen Aspekten seiner Karriere – und war schon damals Gegenstand von Diskussionen. Detering zeichnet Elvis’ musikalische Sozialisation nach: Die Beale Street, schwarze Radiostationen, Gospel in Holzkirchen – all das prägt den jungen Presley. Seine musikalischen Einflüsse sind afroamerikanisch, seine Vorbilder ebenso. Dass er dennoch zur Ikone eines weißen Massenmarkts wurde, ist kein Zufall, so Detering, sondern Folge einer industriellen Ordnung, die kulturelle Aneignung nicht verhindert, sondern produziert.
Detering weicht dabei der oft geäußerten Kritik an Elvis’ Umgang mit schwarzer Musik nicht aus. Er zitiert Richard Middleton und spricht von »boogification« und »gospelization«, also dem Moment, in dem weiße Künstler schwarze Ausdrucksformen aufnehmen, um sie marktfähig zu machen. Gleichzeitig betont er, dass Presley nie vorgab, diese Musik erfunden zu haben – und dass seine Aneignung nicht als Verkleidung, sondern als Teil seiner Identität zu verstehen sei. Ein Kind, das mit schwarzer Musik aufwächst, empfinde sie nicht als fremd, sondern als selbstverständlich.
Was das für die Zuhörenden bedeutete, lässt sich an einem Zitat ablesen: »Viele wussten anfangs nicht, ob Elvis weiß oder schwarz sei.« Diese Unsicherheit war es, die ihn sowohl zum Skandal als auch zum Phänomen machte. In einer Zeit, in der musikalische Genres und Märkte klar entlang vermeintlich rassischer Linien getrennt waren, wurde Elvis’ Stimme zur Projektionsfläche – für Sehnsüchte, aber auch für Ängste. Detering erzählt, wie Radiostationen sich zunächst weigerten, ihn zu spielen, weil er »zu schwarz« klang, während andere ihn gerade deshalb feierten. Die Tatsache, dass seine Stimme nicht eindeutig zuordenbar war, stellte die gewohnten Kategorisierungen infrage – und machte ihn zum Katalysator eines kulturellen Umbruchs.
Improvisation und Identität
Die Vorlesung wird teils auch zur kleinen Kulturgeschichte der Vereinigten Staaten. Detering verbindet musikalische Analyse mit sozialen Kontexten: Race, Class, Gender – bei Elvis greife alles ineinander. Seine Tanzbewegungen irritierten Geschlechternormen, seine Kleidung zitiere Captain Marvel ebenso wie Marlon Brando, und seine Stimme durchbreche klare ethnische Zuordnungen.
Besonders eindrücklich beschreibt Detering den Moment, in dem Elvis während der improvisierten Live-Passage des Specials – im schwarzen Lederanzug, ohne Gitarrengurt – spontan zur Gitarre greift. »Man, it has been a long time, baby«, hört man Elvis sagen, zögernd, aber entschlossen. Songs wie One Night with You entstehen neu, nicht perfekt, aber echt.
Genau in so einer improvisierten Passage, Elvis redet über die wahre Herkunft seiner Musik, überblendet die Szene in Claude Thompsons Tanzeinlage zu Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Für Detering ein klanglicher und visueller Rückgriff, der wie ein Echo an Elvis’ musikalische Herkunft erinnert. Die Grenze zwischen Performer und Herkunft, zwischen Sender und Musikgeschichte verschwimme. Elvis werde in diesem Moment nicht nur zum Interpreten, sondern zum Teil einer musikalischen Erzählung, die weit über ihn hinausweist. Während der Vorlesung bekommt man den Eindruck, Elvis’ Performance und die Geschichte, aus der sie stammt, überlagern sich. Später, während der Aufnahmen zum Special, schlägt Elvis selbst ein Gospel-Medley mit schwarzen Backgroundsängerinnen vor. Dies sei kein kalkulierter Akt, sondern ein Zeichen der Zugehörigkeit.
Dass diese Momente in eine amerikanische Weihnachtsshow eingebettet sind, wirke fast trotzig und bekommt zusätzliche Schärfe durch einen Blick zurück: Nur acht Monate zuvor hatte die Musikerin Petula Clark den Sänger Harry Belafonte bei einer gemeinsamen Fernsehaufnahme am Arm berührt. Dass eine weiße Frau einen schwarzen Mann auf offener Bühne anfasste, sorgte für Empörung – inszeniert von Steve Binder, demselben Produzenten.
Detering erzählt in diesem Kontext, dass Elvis’ Manager, Colonel Tom Parker, ursprünglich ein ganz anderes Format im Sinn hatte: eine brave, familienfreundliche Weihnachtsshow mit Glitzer und Christbaum. Doch Binder und Elvis setzten sich durch. Statt Here Comes Santa Clause gab es Protestsongs, statt Weihnachtspullovern Leder. Der Colonel, so wird kolportiert, verließ die Produktion in dem Glauben, alles laufe nach Plan – bis er am Ausstrahlungstag sah, was wirklich daraus geworden war.
Popmusik als Predigt
Gegen Ende der Vorlesung schlägt Detering den Bogen zurück zu seiner zentralen These: dass If I Can Dream eine Predigt sei – im besten Sinne. Nicht moralisch, nicht belehrend, sondern spirituell. Elvis, so Detering, sei kein Theologe, aber ein Sänger, der sich in den Dienst einer Botschaft stelle. Und in dem Moment, in dem er das tut, wird seine Stimme für die Zuhörenden zu mehr als Musik.
Detering beendet die Vorlesung so, wie er sie begonnen hat. Elvis steht am Ende des Specials allein auf der Bühne. Das Licht ist klar, die Farben sind es auch: Schwarz, Rot und Weiß. Kein Showglanz, keine Kulisse. Nur diese eine Figur im weißen Anzug – vor dunklem Hintergrund, zwischen Andeutungen von Blut, Schatten, Klarheit. Die Farbsymbolik, sagt Detering, sei bewusst gewählt. Weiß stehe hier nicht für Unschuld, sondern für Entschlossenheit. Es sei eine Geste, fast schon ein Bekenntnis.
Es wird auf einen Satz verwiesen, der in den Proben gefallen sein soll: »I am never gonna sing another song that I don’t believe in.« Detering kommentiert ihn nicht und gerade dadurch entfaltet er seine Wirkung.
Am Ende folgt kein Applaus, sondern Tischklopfen – wie es sich für eine Vorlesung gehört. Die Reihe ist damit gelungen eröffnet und lässt bereits erahnen, wie vielfältig die kommenden Vorlesungen sein werden. Heinrich Detering hat es geschafft, einen Popsong aus dem Jahr 1968 in einen literatur- und kulturwissenschaftlichen Resonanzraum zu stellen, ohne ihn zu entzaubern. Und das Publikum hört zu, als ginge es um weit mehr als nur Musik.