Aria Aber genießt für ihre englischsprachige Lyrik kommerziellen Erfolg und gute Kritiken. Nun traut sie sich an einen ersten Roman. Dieser bemüht sich, die Coming-of-Age Geschichte der Protagonistin Nila in den Kontext der rassistischen Gewalt zu setzen, die sie erfährt und um sich beobachtet. Dieses Ziel geht im sprachlichen und inhaltlichen Chaos des Romans unter.
Von Cara Hösterey
Bild: Wikimedia (cropped), Mahagaja, CC BY-SA 2.0
In Aria Abers Debütroman Good Girl verliert sich die noch keine zwanzig Jahre alteNila ambitioniert in der Berliner Techno-Szene, inklusive tage- und nächtelanger Drogenexzesse, übergriffiger älterer Männer und deplatzierten akademischen Geschwafels über die Ungerechtigkeiten ihrer Zeit. Die Zeit ist die der NSU-Morde, in denen der Rassismus, der Nilas Leben prägt, einen Höhepunkt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung erreicht. Nila und ihre Bekannten trennen Welten, auch wenn sie sich schwitzend in den Armen liegen und gemeinsam runterkommen; ihre Eltern sind afghanische Migrant:innen, die sie in Armut in Gropiusstadt großgezogen haben, oder wie Nila es nennt, in dem »Gettoherz« der Stadt. Nila hasst alle, die »das gleiche Schicksal [erleiden]« wie sie. Dieser Hass treibt sie dazu, ihre Herkunft zu verbergen. Mal kommt sie aus Griechenland, mal aus Israel oder Italien, irgendwas Mediterranes, aber bloß nichts Arabisches. Statt aus Gropiusstadt, umgeben von Armut und mit Ameisen in der Wohnung, kommt sie dann aus dem gemütlichen Pankow. Ihre tote Mutter, den depressiven Vater, den taxifahrenden Onkel, die sie in ihrem Kopf verfolgen, die erwähnt sie nicht. Wenn ihre weißen Freund:innen Krieg, Imperialismus und Gentrifizierung diskutieren, schweigt sie.
Liebesbeziehung nach Schema: Der ältere Bad Boy
So verschleiert stellt sich Nila auch Marlowe vor, den Held, Antiheld, Bösewicht ihrer Coming-of-Age Geschichte. Marlowe ist Kalifornier, groß, hat lockige Haare und trägt eine lässige Lederjacke, als die beiden im »Bunker« (gemeint ist das Berghain) zum ersten Mal miteinander sprechen. Marlowe, der einmal ein erfolgreicher Schriftsteller gewesen ist, ist jetzt mit Mitte dreißig im Bunker hängen geblieben. Das alt gewordene Wunderkind der Literaturszene findet sich in ambigen Beziehungen mit Frauen, die eben noch Mädchen waren. Besonders, mystisch soll er sein, wie er Siddhartha und Proust liest und seine Moscow Mules mit Sojamilch zubereitet. Eigentlich ist er aber nur ein Schatten der literarischen Bad Boys, die eigentlich keine Jungen mehr sind, eher eine Skizze einer Figur als ein differenziertes Portrait. Die junge, abenteuerliche Nila, die Photographin werden will, um »Echtes« einzufangen und überzeugt ist, dass sie eh nichts zu verlieren hat, passt perfekt in sein Schema.
Die Beziehung von Nila und Marlowe nimmt den ganzen Roman ein. Sie entwickelt sich von einer verbotenen Affäre mit Sex, der Nila nie ganz befriedigt, in eine ernste missbräuchliche Wohnsituation, nachdem sie bei ihm einzieht. Ihre Dynamik folgt Punkt für Punkt dem Leitfaden für die Art toxischer Beziehung, die in an Mädchen oder junge Frauen gerichteten Büchern Routine sind. Genau das ist das zentrale Problem der Erzählung: Die flache Beziehung zwischen Nila und Marlowe monopolisiert den Roman fast komplett. Und das müsste eigentlich kein Problem sein, denn die Geschichte einer jungen Frau, die sich umgeben von unterdrückerischen Strukturen und Zukunftsängsten in eine ungesunde Beziehung stürzt, ist eine, die eigentlich emotional nachvollziehbar sein sollte.
Verwirrte Nila, wirre Erzählstruktur
Aria Aber entscheidet sich für eine ältere Nila als Erzählerin, der jede Distanz vom Geschehen fehlt. Statt die Lesenden einzuladen, Nilas Entscheidungen mit einer humoristischen und empathischen Perspektive zu betrachten, wird man in einer Welt allein gelassen, in der Nila unironisch an Platons Symposium denkt als sie zwei Liebende beobachtet, Marlowe den Techno Berlins als »deleuzianisch« beschreibt und die Hauskatze einer Freundin nach Leo Trotzki benannt ist. Für die Erzählerin ist das alles »damals« gewesen, doch wo sie jetzt in ihrem Leben steht, bleibt völlig unklar. Die Bemühung um emotionale Greifbarkeit, indem Nilas Rassifizierung, ihre Armutserfahrung, der Spagat zwischen einer konservativen Familie und dem Hedonismus ihrer Freund:innen überreichlich wiederholt werden, strapaziert die Erzählung und bewirkt das Gegenteil. Was als Eindruck überlebt, sind die erstickenden kulturellen Referenzen, weil nichts einfach ist, sondern zwingend im Bezug zum Kanon gedeutet werden muss. In der Rezeption verfestigt sich das beklemmende Gefühl, dass hier eine gute Idee auf der Strecke geblieben ist.
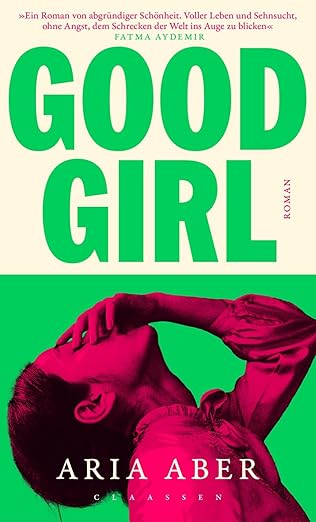
Good Girl
Claassen: 2025
400 Seiten, 25 €
Abers ungeschickte Erzählstrategie zeigt sich auch in dem Vorgehen, dass sie spannende Informationen über das Innenleben der Figuren immer etwas zu schnell und zu direkt preisgibt. Schon auf den ersten Seiten sagt Nila ganz offen, wie sehr sie ihre Herkunft hasst. Es ist kein Geheimnis, was sich peu à peu durch ihr Handeln offenbart. Wieso also die ständige Wiederholung der gleichen Situationen, wo doch schon klar ist, worum es geht? Diese Dynamik, das ständige Fragen nach ihrer Herkunft ist für viele Menschen Realität. Bei Abers Roman verlieren jedoch Nilas Gedankenäußerungen durch die Überkommunikation ihr emotionales Gewicht. Auch, dass sie »selbstzerstörerisch« ist, »krankhaft« über ihre Lebensrealität lügt, fällt schon im ersten Kapitel. Viele Szenen im »Bunker« könnten gestrichen werden, ohne dass die Aussage des Romans darunter leiden würde. Das abgegriffene Mantra »show don’t tell« mag restriktiv sein, ein »show and tell« erschafft aber auch keinen packenden Roman.
Die wohl gröbste Verfehlung des Romans zeigt sich in der von Aber selbst verfassten Übersetzung, in der kurios offensichtliche Fehler gemacht wurden. Eine einfache Wortsuche in der deutschen Übersetzung und dem englischen Original zeigt, dass das englische »pathetic« konsequent als »pathetisch« übersetzt wird, konträr zur Bedeutung im englischen Original: Nilas große Träume sind nicht pathetisch, sie sind erbärmlich, das denken die anderen jedenfalls, genauso wie Marlowe ihre Einsamkeit wohl eher bemitleidenswert findet, anstatt darin Pathos zu sehen. Wie das im Lektorat untergegangen sein kann, ist ein seltsamer Umstand, besonders in Anbetracht der Medienpräsenz, die Aber im englischsprachigen wie deutschsprachigen Diskurs auf sich zieht. Dies scheint symptomatisch für die Massenproduktion von semi-literarischen Romanen zu sein, die sich an traurigen, bisexuellen Frauen mit verschiedensten Suchtproblemen und Pathologien abarbeiten. Somit reiht sich die sprachliche Unklarheit in die Verwirrung durch die Erzählstimme ein, was es unverständlich macht, welche Geschichte hier eigentlich erzählt werden soll.
Am Ende siegt Nila dann doch: Gegen Marlow, Berlin, sich selber
Was Aber trotz der Schwächen ihres Romans in Good Girl gelingt, ist, das Portrait einer jungen Frau zu zeichnen, die es nicht lassen kann, sich in jegliches Chaos zu schmeißen, das sich ihr bietet. Und trotzdem – Nila kennt sich, besser, als ihre Eltern, Freund:innen oder Marlowe, das zeigt sie von Anfang an:
»›Gott, was machst du mit mir, du verwirrst mich. Ich wollte dich beschützen,‹ [sagt Marlowe].
›Ich will nicht beschützt werden.‹
›Ja, das sehe ich, das ist ja das verwirrende daran. […] Du weißt, dass ich dich ruinieren werde, oder? Auch wenn ich versuche, es nicht zu tun.‹
›Du ruinierst mich nicht‹«
Denn das muss man Nila lassen, am Ende ruiniert er sie auch nicht. Sie erlangt durch ihn Zugang zu Berlins künstlerischer Elite, vertieft ihre Leidenschaft fürs Fotografieren und schafft es damit an britische Universitäten und raus aus der verhassten Stadt. Ihn wird sie dann auch noch los. Nila lebt weiter, trotz unzähliger Stunden auf Amphetaminen und ohne Essen, trotz Marlowes Erniedrigungen, trotz des gewaltvollen Rassismus, der sie umgibt.






