Der Slogan ›Jeder Tag ist 8. März!‹ schafft es jedes Jahr auf die Demos beim feministischen Kampftag. Bei Litlog nehmen wir diese Losung ernst: An jedem Tag sollte man sich (auch) mit feministischen Themen beschäftigen und sich dem Kampf für gleiche Rechte widmen. Deshalb gibt es hier eine kleine Häppchenauswahl feministischer Klassiker, Praktiken, Themen. Wir sagen: Bon appétit!
Bild: Via Pexels (cropped), CC0
Ursula K. Le Guin: The Left Hand of Darkness
Von Frederik Eicks
Winter – der Name eines abgelegenen Planeten am Rande des von Menschen bewohnten Universums. Auf diesem bitterkalten Stern landet ein einzelner Botschafter der sogenannten Ökumene, einer Allianz von über achtzig Planeten, um die Länder auf Winter von einem Beitritt zu überzeugen. Der junge Mann namens Genly Ai stößt dabei auf allerlei Probleme: Ein verrückter König im Land Karhide schickt dummerweise Ais wichtigsten Fürsprecher ins Exil; die von Ränkeschmieden korrumpierte Bürokratie im Nachbarland Orgoreyn ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um sich auf Deals mit vorgeblichen Außerirdischen einzulassen.
Es dauert eine Weile, sich in diese Alien-Diplomatie reinzufuchsen. Auch der übliche Sci-Fi-Mumble-Jumble voller Neologismen – shifgrethor, kyorremy – kann Lesende zu Beginn etwas ratlos machen. Nur nach und nach wird klar, worüber die Figuren da eigentlich sprechen. Gerade dadurch entsteht aber auch das kitzelige Gefühl, dass es wirklich eine völlig fremde Welt ist, die man in Ursula K. Le Guins Sci-Fi-Klassiker The Left Hand of Darkness betritt. Lesenderweise erfährt man am eigenen Leib ein Stück der Irritation des Protagonisten angesichts einer Gesellschaft irgendwo zwischen feudaler Monarchie und steam-punkigem technologischen Fortschritt.
Die größten Steine auf Genly Ais Weg sind nicht die ihm fremden Sprachen, die er in Vorbereitung auf seinen Einsatz gelernt hat, und nicht einmal das ihm verhasste Klima, das ihn selbst im Sommer frieren lässt. Sein größtes Problem ist, dass die Menschen auf Genthen, so wird der Planet von seinen Einwohnern genannt, »hermaphrodites« sind: Weder biologisch noch sozial konstruiert existiert in dieser Welt das uns »Terrans«, wie wir Erdenbewohner:innen bei Le Guin heißen, so tief prägende Konzept von Geschlecht. So verlockend das auch klingt, es bedeutet nicht die Abwesenheit sämtlicher Verwerfungen, die auf der Erde so eng an Geschlechtlichkeit gebunden sind. Es gibt Hierarchien. Es gibt auch physische Gewalt, die aber, und das ist der Unterschied zu unserer Welt, nicht in organisierter Form von großen Menschengruppen angewendet wird, heißt: Es gibt keinen Krieg. Ai, der hier mit seinem Geschlecht als »pervert« gilt, schafft es nicht, die ihn umgebende Ungeschlechtlichkeit wirklich zu verstehen. Sein diplomatisches Unterfangen steht auf der Kippe.
Es ist ein großes Gedankenexperiment, das Le Guin in ihrem 1969 erschienenen Roman, der als eines der ersten Werke feministischer Science-Fiction gilt, anstellt. Nicht die Sprache, eine solide Prosa mit zarten poetischen Einsprengseln, macht ihr Schreiben so herausragend. Das Buch besticht auch nicht durch eine besonders ausklügelte Erzählweise, erzählt schlicht mit mehreren, überlegt zusammengestellten Stimmen, ohne (oder nur ganz kurz) Verwirrung aufkommen zu lassen. Was Le Guin auszeichnet, ist die Fähigkeit zum Entwurf einer Welt, die so anders und doch glaubwürdig ist – ein kraftvoller Akt der Imagination.
The Left Hand of Darkness ist in seinem Kern ein Sci-Fi-Roman, der auch innerhalb der Genreszene großes Renommée genießt und dessen politische Aspekte zwar zentral sind, aber die Erzählung nicht bis ins Letzte dominieren. Man muss eben auch Bock haben auf Alien-Diplomatie und Weltraum-Sprech. Aber dann ist das ganz geil.
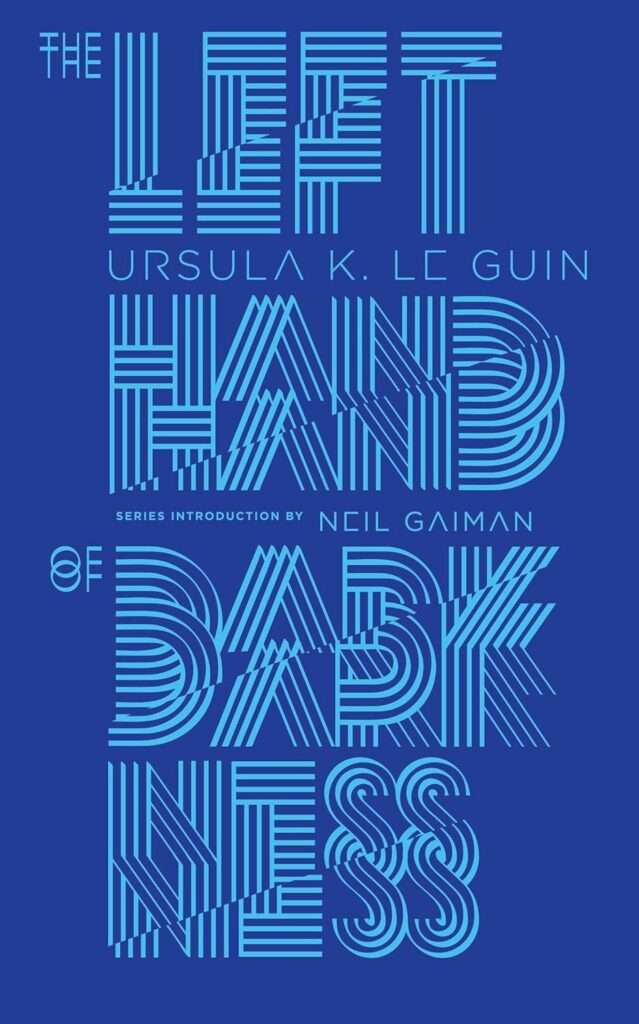
The Left Hand of Darkness
Penguin Classics: 2016
288 Pages, $26.00
Donna Haraway: A Cyborg Manifesto
Von Lara Müller
Donna Haraways Essay A Cyborg Manifesto schlug bereits zu dem Zeitpunkt seiner Erstveröffentlichung 1985 große Wellen in akademischen sowie feministischen Kreisen. Der Boden des Manifests nährte auch in den darauffolgenden Jahren eine fruchtbare Diskussionskultur und zählt heute zu den emanzipatorischen Klassikern. Das ist nicht verwunderlich, schließlich strotzt der Aufsatz vor provokanten, aufgeladenen und doch mehrdeutigen Metaphern. Doch kann eine (Re-)Lektüre des Essays in den Tagen von echten Cyborgs – wie künstlicher Intelligenz – etwas zutage fördern, was in den 80ern noch verborgen blieb?
Das Universum, dem sich Haraway gegenübersieht, ist eine der durchbrochenen Dichotomien, wie etwa die von Mensch und Maschine. Die Kreatur, die sich aus den Trümmern der alten Binarität erhebt, versieht Fred Wolf in der ersten deutschen Übersetzung von 1995 ohne Zaudern mit dem feministischen Artikel ›die‹. Die Cyborg, ein Hybrid aus Maschine und Organismus, ist ein Monster, an dessen Erstarkung Haraway die Frage des Überlebens der Gesellschaft knüpft. Der Begriff ›Monster‹ wird von der Autorin nicht negativ gewertet. Haraway spricht für sich selbst, wenn sie schreibt: »Mein Cyborgmythos handelt also von überschrittenen Grenzen, machtvollen Verschmelzungen und gefährlichen Möglichkeiten, die fortschrittliche Menschen als einen Teil notwendiger politischer Arbeit erkunden sollten.«
Die Formulierung »gefährliche Möglichkeiten« bildet die Potentiale und Risiken des Digitalen Zeitalters sprachlich gelungen ab. Haraway spezifiziert diese an späterer Stelle. Auf der einen Seite hätte der »Militarismus und patriarchale Kapitalismus« unsere Cyborgs gezeugt. Diese Einfärbung könne als Kontinuität fortbestehen. Auf der anderen Seite würden Cyborgs ohnehin bereits existieren; was also bliebe, sei nur, sich ihnen anzuschließen und Verantwortung für das eigene Handeln zu tragen.
»Die Maschine ist kein es, das belebt, beseelt oder beherrscht werden müßte. Die Maschine sind wir, unsere Prozesse, ein Aspekt unserer Verkörperung. Wir können für Maschinen verantwortlich sein; sie beherrschen oder bedrohen uns nicht. Wir sind für die Grenzen verantwortlich, wir sind sie.«
Maschinen sind von uns nicht zu trennen, sie sind gefährlich und bieten dennoch Unmengen an Chancen. Das erinnert stark an Überlegungen zu künstlicher Intelligenz (KI), die aufgrund von ChatGPT in den letzten Jahren noch lauter geworden sind. Einerseits reproduziert KI die Informationen, mit denen die Menschheit das textbasierte Werkzeug füttert. Dazu zählen auch Stereotype und Vorurteile, die die KI nachahmt. Andererseits bietet künstliche Intelligenz so viele Vorteile, dass sie mittlerweile fest in unserem Alltag verankert ist. KI ist außerdem ein weiteres Beispiel für die Post-Gender Gesellschaft, die Haraway mit ihrem Mythos entwirft. Sie ist als geschlechtslose Entität weder weiblich noch männlich – und damit ein weiteres Symptom dafür, dass dieses Cyborguniversum jenseits von Dualismen überhaupt existieren kann.
Das wichtigste Werkzeug der Cyborg ist laut Haraway das Schreiben selbst: Nur durch das (Neu-)Schreiben können alte Textualisierungen eine andersartige Wirkung entfalten oder überhaupt neue Diskurse geschaffen werden. In moderner Hinsicht ist die KI ein Reproduktionsorgan, das mit diesen neuen Semiologien ausgestattet werden muss. Was kann das Cyborg Manifesto also Feminist:innen heute noch liefern? Vor allem den Entwurf einer Gegenwart von durchbrochenen Binaritäten, die in einer Zukunft, geprägt von einer radikalen Neudefinition von Identität, mündet.
Birden als feministische Praxis
Von Lisa Marie Müller
2025 wird ein Vogeljahr. Das habe ich beschlossen, für mich. Aber ich möchte auch ein generelles Plädoyer dafür halten und mit diesem Text alle, aber vor allem Frauen dazu ermutigen, sich dem Rabbit Hole ›Vögel‹ hinzugeben, den Trend ›birden‹ (der neue, fetzige Begriff für ›Vogelbeobachtung‹) auszuprobieren oder auch: sich der guten alten Ornithologie anzuschließen.
Nach zwei Vogelexkursionen und diversen Ausflügen ins Grüne sowie ins Internet habe ich gelernt: Die Geschichte der Ornithologie ist von Rassismus, Faschismus und Männern geprägt. Mit den biologistischen und rassistischen Kontinuitäten beschäftigt sich FARN – die Fachstelle für Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz. Die Anlaufstelle erklärt, wie Naturschutz, also auch Vögel und ihre Lebensräume betreffend, insbesondere in Deutschland mit rechten und völkischen Ideologien verknüpft ist (»Umweltschutz ist Heimatschutz« dürften viele schon mal gehört haben). Heute gibt es auch links-grüne Strömungen, die sich für Umweltschutz einsetzen, aber eben auch weiterhin rechtsextreme Gruppierungen, die sich beispielsweise gegen Neophyten/Neobiota aussprechen. Das sind Arten, die sich (irgendwann) neu in einem Gebiet angesiedelt haben, im rechten Weltbild also ›nicht heimisch‹ sind. Es geht viel um das Bekämpfen dieser Arten, die sich breit gemacht hätten, andere verdrängen würden. Rechtsoffene Formulierungen sind selbst bei netten Naturschutzbünden immer wieder zu finden, weil diese Narrative so eng mit deutschem Naturschutz verbunden sind. Interventionen von rechts in den Naturschutz müssen eingedämmt werden. Umweltpolitik muss viel mehr als etwas gesehen werden, das uns alle angeht und emanzipatorisch praktiziert werden sollte.

Warum ist es jetzt cool, birden als feministische Praxis zu verstehen? Neben der Betätigung in male fields (literally) kann man sich vernetzen, Zeit mit Freund:innen in der Natur verbringen und das Ganze in einen größeren Kontext stellen (z.B. durch Angebote von FARN). Außerdem sind Vögel einfach richtig cool. Wer keine birder im direkten Umfeld hat, schüchtern ist oder generell lieber erstmal in einer Signal-Gruppe beitritt, bevor er:sie aktiv wird, dem:der sei letzteres wärmstens empfohlen. Es gibt verschiedene Chatgruppen – ich bin stille Mitleserin in einer überregionalen ›Feminist FLINTA+ Birding‹-Gruppe und hab einiges gelernt. Nämlich Unterstützung ohne Belehrung, einfach nette Hilfe von FLINTA*s für FLINTA*s. Bilder von Federn werden reingeschickt, Informationen dazu geteilt. Es wird sich verabredet, zusammen weitergebildet, organisiert usw.
2025 ist wie gesagt Vogeljahr. Nicht nur, weil viele komische Vögel in Machtpositionen sind und Aktivismus immer wichtiger wird. Am 8. März ab auf die Straße, an den anderen Tagen vielleicht einfach zum Kiessee oder zu den Nilgänsen im Levinpark und Naturschutz nicht den Faschos überlassen!
Jacqueline Harpman: I Who Have Never Known Men
Von Marie Bruschek
Samuel Beckett war bekanntlich dagegen, dass weibliche Schauspielerinnen Vladimir und Estragon in Warten auf Godot spielen – nur Männern war es erlaubt, die Rollen in dem revolutionären Stück zu übernehmen. In eine ähnlich dystopische, karge Welt setzt die belgische Autorin Jacqueline Harpman ihren Roman I Who Have Never Known Men (in der deutschen Übersetzung ist der Titel Die Frau, die die Männer nicht kannte) – als Antwort auf einen Kanon existenzialistischer, absurder Literatur und Dramatik, der von männlichen Autoren und männlichen Figuren dominiert wird. Dementsprechend sind in Harpmans 1995 erschienenen Roman die Geschlechterverhältnisse entgegengesetzt zu Beckets Stück: Männer gibt es kaum, Frauen sind im Fokus der rätselhaften Welt. Der Roman hat zwar schon einen kurzen Hype auf Tiktok erfahren, konnte bisher jedoch nicht den Mainstream erobern.
Der Plot ist recht simpel und stellt seine Leser:innenschaft doch vor große Rätsel – der mysteriöse Text behält seine Geheimnisse zunächst für sich und nur im Versuch, sie zu erkunden, gelangen wir zum Kern des Romans. 40 Frauen sind in einem Bunker eingesperrt, bewacht von Gefängniswärtern. Sie werden am Leben gehalten, doch jegliche Würde ist ihnen genommen: Sie dürfen sich nicht gegenseitig berühren, müssen ihre Körperhygiene und das alltägliche Kochen mageren Essens vor den Argusaugen der Wächter erledigen, die andernfalls mit Peitschenschlägen drohen. Die Frauen reminiszieren ihr altes Leben, bevor ein Einschnitt ihre Erinnerung unterbricht und sie wie aus einem Nebel – womöglich ausgelöst durch Drogen – zurück zu Bewusstsein kommen. Unter ihnen ist die namenlose Ich-Erzählerin, die zu Beginn des Romans etwa 13 Jahre alt ist. Sie kennt nichts außer den grauen Wänden des Gefängnisses. Sie beschäftigt sich intensiv mit der zentralen Frage, die der Text auch an die Lesenden stellt: Wenn sie von aller Freiheit, Individualität, Gesellschaft und Kultur ausgeschlossen ist, ist sie überhaupt ein vollständiger Mensch? Welche Aspekte, in denen wir unsere Menschlichkeit bestätigt sehen, sind intrinsisch?
Doch Harpman gesteht auch ihr, die von den Frauen bloß »das Kind« genannt wird, eine menschliche Existenz mit eigenem Charakter zu. Sie ist mehr als nur ein Stilmittel oder ein Experiment. Und auch sie selbst erkennt: »I was forced to acknowledge too late, much too late, that I too had loved, that I was capable of suffering, and that I was human after all«. Nach einem etwa zwölf Jahre andauerndem Ausharren in trister Existenz geschieht nämlich ein Wunder: Den Frauen gelingt die Flucht. Doch was sie erblicken, ist eine endlose, graue Landschaft, keine Zivilisation in Sicht. Wie bei Warten auf Godot hofft die Erzählerin bis zum Schluss vergeblich – nicht auf Godot, sondern darauf, andere Überlebende zu treffen. Hoffnung, Verzweiflung und Suche nach Sinn stehen im Zentrum des elegant geschriebenen Textes, der mit philosophischer Tiefe und stilistischer Leichtigkeit überzeugt. Während Warten auf Godot für seine Verschlüsselung gelobt wird, muss Harpman für ein ähnliches Level an Rätselhaftigkeit harsche Kritik über sich ergehen lassen.
Die 40 Frauen werden letztlich sesshaft, doch langsam neigt sich ihr Leben dem Ende zu: »We were going to die one by one without having understood anything of what had happened to us«. Und sie, die Erzählerin, bleibt als jüngste allein übrig, auf einem Planeten, der vielleicht gar nicht die Erde ist. Zu Beginn des Romans regt der jüngste der Gefängniswärter Gefühle in ihr, doch bleibt ihre Sexualität abgesehen von diesem Funken unentdeckt. Nach der Flucht wird sie nie wieder einen lebenden Mann treffen. Sie trauert in Gedanken immer wieder darüber, als heterosexuelle Person keine romantische Liebe erleben zu können, da es in dieser Welt keine Männer zu geben scheint.
Was auf Rezeptionsseite deutlich wird: Die Erzählerin hat Männer (abgesehen von den Gefängniswärtern) nie als soziale Gruppe kennengelernt – weder als Gruppe, die strukturelle Gewalt und Oppression ausübt, noch als potenzielle Freunde oder Partner. Auch die männlichen Gefängniswärter erfüllen nicht die typischen Rollen, die wir von Männern gewohnt sind. Die Erzählerin geht davon aus, dass diese wegen ihres Berufes die Frauen kontrollieren und wahrscheinlich selbst Regeln folgen müssen, deren Gründe sie nicht kennen. Eine Gesellschaft, in der Männer strukturell unterdrücken – sei es offen oder hinter dem Schleier formaler Gleichberechtigung – ist ihr völlig fremd; sie hat keine Erfahrung mit solchen Machtverhältnissen, wie sie für uns alltäglich sind.
Was von I Who Haver Never Known Men in Erinnerung bleibt, ist Folgendes: »Das Kind« ist trotz seiner Existenz im leeren Raum ein vollwertiger Mensch, der Liebe erfahren hat – eine ebenso wertvolle Liebe wie die romantische, nämlich eine platonische zwischen Frauen.
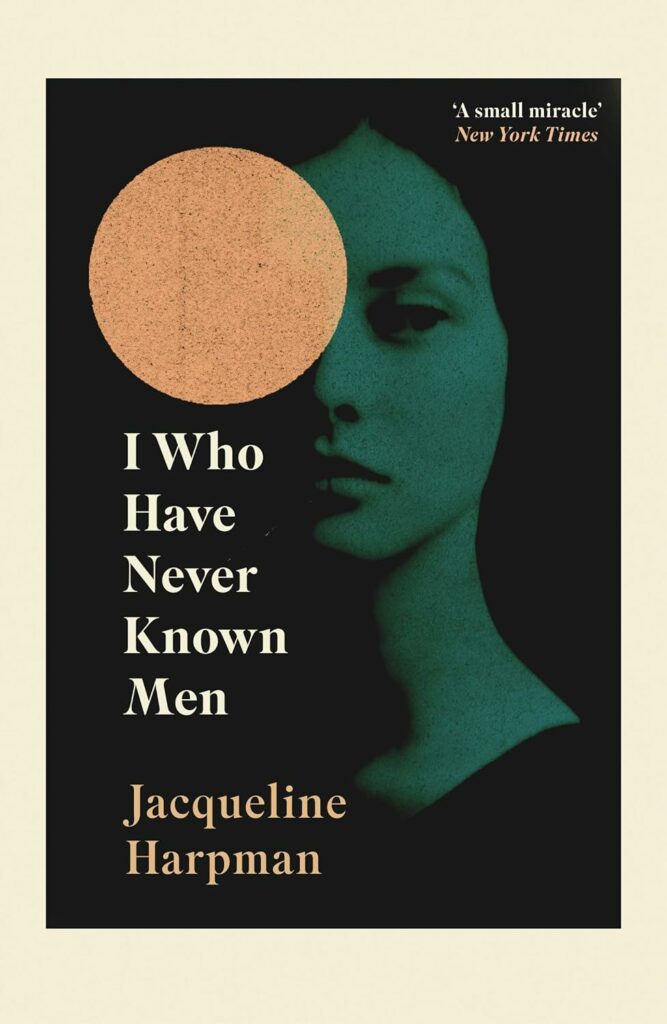
I Who Have Never Known Men
Penguin Vintage: 2019
208 Pages, £20
Doris Lessing: Das goldene Notizbuch
Von Sophie-Marie Ahnefeld
In meiner Ausgabe des goldenen Notizbuches von Doris Lessing steckt als Lesezeichen die Werbekarte eines Frauenfitnessstudios aus den 80ern. Darauf zu sehen ist eine Frau in roten High Heels mit Hantel in der Hand. Wie Frauen eben so Sport machen. Das hier ersichtliche Spannungsverhältnis von sexistischem Abbild, das in diesem Klassiker feministischer Literatur steckt, hat mich so sehr fasziniert – ich musste das Lesezeichen meiner Vorleserin einfach übernehmen. Frauen im Identitätskonflikt mit sich selbst durch reaktionäre Erwartungshaltungen von außen: Auf diesen Zustand mentaler Zerrüttung hat Doris Lessing Antworten.
Dass der 1962 veröffentlichte Roman der britischen Schriftstellerin einmal als ›Klassiker des Feminismus‹ gelten würde, war von Lessing nie geplant gewesen, auch wehrte sie sich stets gegen diese Zuschreibung. Das ist verständlich, schließlich ging eine solche Einordnung oftmals mit Tokenismus gegenüber Autorinnen einher. 2007 wurde Lessing mit dem Literaturnobelpreis gekürt, wobei Das goldene Notizbuch als ihr Hauptwerk betrachtet wurde. Fakt ist: Lessing hat kein feministisches Buch geschrieben, um ein feministisches Buch geschrieben zu haben, nein, der Roman ist feministisch, weil Lessing mit scharfem und feinfühligem Blick ihre Lebenswelt beschreibt und dabei die schwelenden Mechanismen von Sexismus, Kolonialismus und sozialer Ungerechtigkeit im 20. Jahrhundert offenlegt.
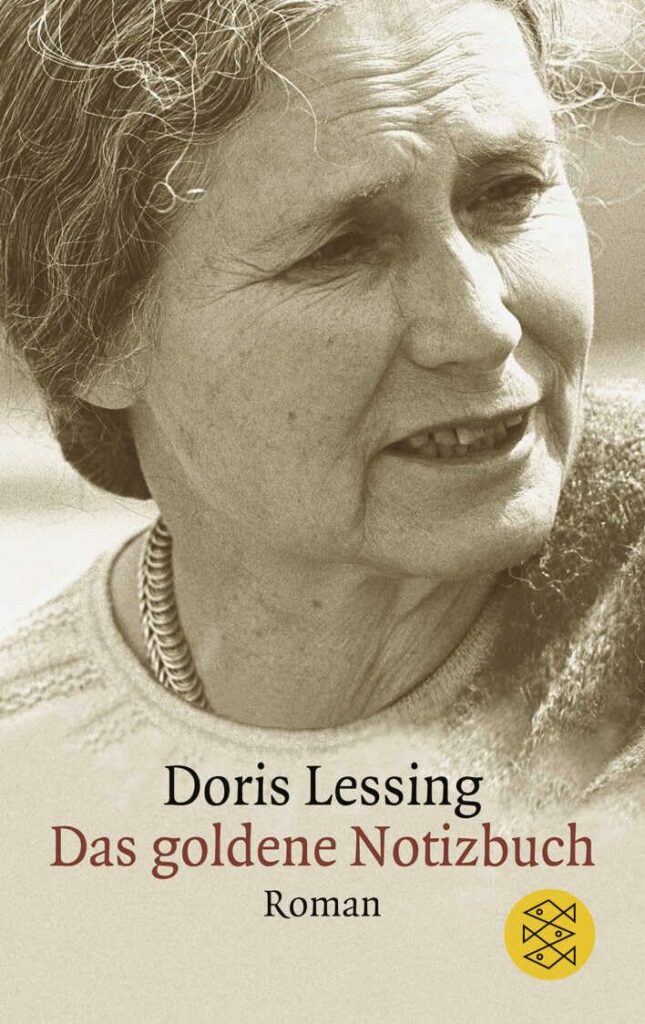
Das goldene Notizbuch
Fischer: 1989
800 Seiten, 22 €
Auf circa 800 Seiten verwebt Lessing die Fäden des Lebens von Anna Wulf, auf dass ein Ganzes entstehe. Wer ist Anna Wulf? Die fiktive Schriftstellerin in Schaffenskrise gibt auf diese Frage mindestens vier Antworten in Form von verschiedenfarbigen Notizbüchern, die sie abwechselnd führt: Schwarz für Anna, die Schriftstellerin, Rot für die engagierte, doch zunehmend desillusionierte Kommunistin, Gelb für eine ihr ähnliche Romanfigur im Roman namens Ella und Blau für tagebuchähnliche Einträge der Anna, die über die verschiedenen Krisenerfahrungen ihres zersplitterten Lebens als geschiedene und alleinerziehende Frau mittleren Alters im London der späten 50er Jahre in eine Spirale der Verzweiflung gerät. Zum Symbol des Versuches, sich ihrer zerrissenen Identität in Gänze zu stellen, die Fragmente ihres Selbst wieder zusammenzukleben, wird das goldene Notizbuch, das sie eines Vormittages in einer Schreibwarenabteilung entdeckt. In dieses Notizbuch münden die Fäden von Annas verstreuten, diffusen Einzelteilen.
Lessing selbst sagte in einem Interview, der Roman habe »ein Eigenleben. Ein sehr lebendiges Eigenleben.« Und so ist es. Die wachsame Introspektion Annas erlaubt ein tiefes Eintauchen in ihre Erinnerungen an die koloniale Gesellschaft des heutigen Simbabwes der 40er Jahre, das intellektuelle, politische London der 50er und ihre sozialen Beziehungen, insbesondere die innige Freundschaft zu der gescheiterten Künstlerin Molly, einer weiteren »ungebundenen Frau«. Molly: »Ungebunden. Weißt du, als ich fort war, habe ich über uns nachgedacht, und ich bin zu dem Schluß gekommen, daß wir ein völlig neuer Frauentyp sind.«
Das goldene Notizbuch entwickelt einen ungeheuren Sog. Daran unabdingbar gekoppelt ist die tiefe Verflechtung und Identifikation mit Annas psychischen Zuständen – über weite Teile eine abgründige Erfahrung. Und doch: Lessing lässt Anna tiefgreifenden Fragen nicht ausweichen, sondern konfrontiert sie, konfrontiert sich und ihre Leser:innen und darin liegt etwas Mutiges.






