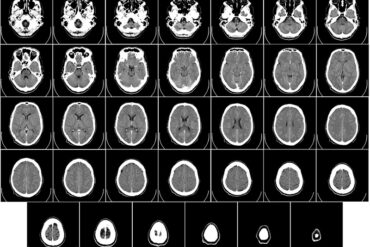Yael Inokai lässt in ihrem Buchpreis-nominierten Roman Ein simpler Eingriff nichts aus, was Menschen zu fühlen möglich ist und beschreibt die lesbische Liebe in all ihren wundervollen Facetten. Ein Roman zum Schaudern und Hoffen.
Von Frida Labitzke
Merets Leben verläuft in strengen Bahnen, richtet sich nach Regeln, die sie befolgen kann und die ihr Halt geben. In Yael Inokais Roman Ein simpler Eingriff merkt die Krankenschwester bald nach dem Zusammentreffen mit ihrer Kollegin und Zimmermitbewohnerin Sarah, dass hinter einigen Eingriffen, die in der Klinik vorgenommen werden, eine trügerische und grausame Hoffnung steckt. In den drei Kapiteln, die nach Personen eingeteilt sind und sich ihrer jeweiligen Beziehung zu Meret widmen, schildert Inokai Merets Weg in die Freiheit, zur Liebe – und das weder kitschig noch verklärt. Vor allem durch den kurzen Aufbau der Sätze und die genauen Beschreibungen von Vorgängen und Gefühlen hat der Text einen angenehmen Lesefluss.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Patientin Marianne, durch die vor allem Merets Berufshaltung eingeführt und ihr schwindender Glauben an die Operationen aufgebaut wird. Im zweiten Teil des Romans wird dieser Glaubensschwund durch Sarah und ihre gemeinsame Liebe weiter ausgeführt. Abgerundet wird der Text dann durch das Kapitel, das Meret selbst dediziert ist.
Inokai beschränkt sich in ihrem Roman allerdings nicht nur auf die grausamen Eingriffe an den vermutlich unter Epilepsie leidenden Menschen. Sie behandelt queere Themen, ohne mit dem Finger darauf zu zeigen, als etwas, das viele Menschen betrifft. Gleichzeitig webt sie ein unverarbeitetes Kindheitstrauma ihrer Protagonistin mit in die Geschichte ein. So sind weder der von ihr beschriebene Eingriff noch ihr Text simpel, sondern ihre Themen und Figuren vielschichtig und vielseitig: Gefühle beschreibt Inokai besonders intensiv, sie werden stark (aus-)gelebt – sowohl Merets innerliche unterdrückte Wut als auch ihre Liebe zu Sarah und ihr Beschützerinneninstinkt für Marianne gleichermaßen.
Ein simpler Eingriff
Narkose, Schnitt, ein paar Sätze sprechen – fertig. Neuer Mensch, neues Leben. Das ist es, was den Frauen versprochen wird. Der Wunsch nach Normalität oder der Druck der eigenen Familie treibt sie, die unter einem im Roman schlicht ›Wut‹ genannten Phänomen leiden, in die Hände des Doktors. Ein simpler Eingriff, so erklärt er es ihnen. Doch: »Aller Einfachheit zum Trotz war es ein delikates Vorhaben. Angst macht die Dinge delikat.« Und so beginnt selbst die zunächst so sichere Meret zu zweifeln. Es ist vor allem Hoffnung, die sie zu Beginn des Romans noch an den Eingriff glauben lässt. Auch das Mitgefühl, das sie für die Frauen hegt, nutzt sie als Antrieb für ihre Arbeit. Vor allem dient ihr beides aber als Mittel, um den grausamen Eingriff vor sich selbst und vor anderen zu rechtfertigen. Lediglich bei Sarah gelingt ihr das nicht.
Da ist etwas in Ihnen drin, und ich werde es zum Schlafen bringen. Es schläft dann für immer. So einfach ist das.
Marianne will endlich das erhoffte bessere Leben, das sich ihre Familie für sie erträumt. An ihrer Figur wird deutlich, dass einige der Patient:innen unter Epilepsie leiden, denn Marianna erlebt krampfende Anfälle, bei denen sie nicht länger die Kontrolle über sich oder ihren Körper hat. Sie ist außerdem impulsiv und spricht aus, was sie denkt. Gemischt mit den Anfällen wird ihr dies als besagte ›Wut‹ ausgelegt und nicht als Krankheit erkannt, gegen die sie nichts tun kann. Zu ihr hegt Meret eine engere Beziehung als zu anderen Patient:innen: Schon während des ersten Anfalls holt Meret keine Hilfe, sondern will, dass Mariannes ›Wut‹ ausläuft. Sie gibt ihr Raum, anstatt sie einzuengen. Hier zeigt sich das erste Anzeichen von Merets Sinneswandel, den Sarah bald voranbringen wird.

Yael Inokai
Ein simpler Eingriff
Hanser Berlin: Berlin 2022
192 Seiten, 22,00€
Inokai schafft es, die Krankheit und den Umgang damit so zu beschreiben, dass die Leser:innen merken, was zwischen den Zeilen passiert. So geht Meret nach ihrem Arbeitstag beispielsweise immer mehrfach duschen, um den Geruch der Krankheit von sich abzuwaschen. Selbst den Todesgeruch will sie nicht mit solch einer Intensität loswerden, denn die Angst vor diesem ist sehr viel geringer als die vor dem Leben als ›aussätzige‹ Person. In Merets Welt ist klar: Wer unter der ›Wut‹ leidet, hat keinen Ausweg außer der Operation. So wird das Duschen zum Symbol der Angst, das die Autorin in ihren Text clever als Anspielung auf eine Zeit einbaut, in der mentale Krankheiten oder aber Queerness noch als ›entfernbare Übel‹ galten. Auch wenn der Name nie fällt, beschreibt Inokai in ihrem Roman die Lobotomie. Sie kritisiert damit auch eine perfide Gesellschaft, in der es heute zwar keine Lobotomien mehr, aber immer noch Praktiken gibt, die alles Nicht-Hetero-Gesunde pathologisieren und zu korrigieren versuchen.
Sie nahm die Spannung in der Luft, griff nach ihr mit beiden Händen und zog sie lang.
In Meret selbst schläft eine tiefe, unterdrücke und echte Wut, die unmittelbar mit ihren prägenden Kindheitsjahren und dem prügelnden Vater zusammenhängt. Diese ihr eigene Wut zeigt sich selten und richtet sie sich auf ihre Schwester, die den Vater immer provozierte, auf die Patient:innen, die so hilflos sind, auf sich selbst. Sie äußert sich in unterdrückten Schreien, im Schlagen in das Kopfkissen. An dieser echten Wut zeigen sich die unterschiedlichen Ebenen, die von der Autorin gezogen werden: Beim Ausdruck von Wut gibt es Regeln, so ist er bei Frauen verpönt und bei Männern – im Besonderen Ärzten – gefordert: Sie sollen ihrem Ärgern Luft machen. Inokai stellt an solchen Unterschieden im Subtext Hierarchien heraus, sodass sich das Geflecht und die Struktur der Roman-Welt vor dem Auge der Leser:innen ausbreiten.
Lesbian is not a dirty word
Auch die Liebe zwischen Meret und Sarah findet ihren Platz in der Geschichte und wird authentisch und präzise beschrieben. Die Autorin schafft es, dass sogar die Sex-Beschreibungen weder pornoartig noch unangenehm, sondern realitätsgetreu dargestellt und für den female gaze kreiert sind. Die Liebe der Frauen ist vor allem intensiv. Sie spüren die Anwesenheit wie die Abwesenheit der anderen, finden sich in den Details des Alltags an ihr Gegenüber erinnert, fühlen Lust und Liebe zu gleichen Teilen:
Der Gedanke an Sarah flutete mich mit plötzlicher Wärme. Ich merkte, wie ich errötete. […] Spürte die Wärme unter meiner Haut und wusste, was sie bedeutete.
Trotzdem wird nicht nur beschönigt: Auch wenn im gesamten Roman keine Hinweise auf Zeit oder Ort existieren, ist klar, dass Meret und Sarah ihre Liebe verstecken müssen. Der Text macht deutlich, dass in der Romanwelt auch für queere Menschen Operationen existieren.
Wenn in dem Roman auf den ersten Blick wenig Freudiges zu stecken scheint, wird doch schnell klar, dass es doch ein Text mit vielen Hoffnungsschimmern ist. Inokais Schreibstil ist dabei aber nie verkitscht, sondern sie schafft es, eine Brücke zwischen Glück und Leid zu schlagen, was sich nicht letztlich daran zeigt, dass die zweite Hälfte des Romans sehr viel deutlicher der Liebe und weniger der Wut gewidmet ist. Dadurch, dass weder Handlungsort noch -zeit bekannt sind, zeichnet sich eine offene Kritik auch an der heutigen Gesellschaft ab. Besonders bei Merets Figur könnte sich noch deutlicher ihre Abneigung gegen die Eingriffe herauskristallisieren und die Kritik noch stärker spiegeln, doch der Roman schafft es trotzdem, dass man beim Lesen alle möglichen Gefühle auf einmal durchlebt. Er hat noch viele Facetten und Bilder zu bieten, die in dieser Rezension keinen Platz gefunden haben.