Ronya Othmanns Roman Vierundsiebzig behandelt den Genozid des IS an den Êzîden im Irak im Jahr 2014. Durch die Verbindung von historischen Fakten und persönlichen Erlebnissen von Verwandten entsteht ein eindringliches Werk, das ein kaum bekanntes Kapitel der Geschichte sichtbar macht und gegen das Vergessen ankämpft.
Von Cecilia Hesse
Im August 2014 verübte der sogenannte Islamische Staat (IS) einen systematischen Völkermord an den Êzîden (häufig auch Jesiden genannt) im Nordirak. Die Terrormiliz fiel in die Region Shingal (Sindschar) ein, ermordete tausende Menschen und verschleppte Frauen und Kinder, die als ›Ungläubige‹ versklavt, vergewaltigt oder zwangsverheiratet wurden. Was dort geschah, war der 74. Pogrom in der langen Geschichte der Êzîden – eine kaum vorstellbare Zahl, die titelgebend für Ronya Othmanns Roman Vierundsiebzig ist.
Ronya Othmann, 1993 in München geboren, ist die Tochter eines kurdisch-êzîdischen Vaters und einer deutschen Mutter. Sie arbeitet als Journalistin und Autorin von Lyrik, Prosa und Essays. Bereits ihr Debütroman Die Sommer (2020) fand große Beachtung. Für ihren Lyrikband die verbrechen (2021) wurde sie mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet. Ein Auszug aus Vierundsiebzig gewann 2019 den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb und stand in der im März 2024 erschienenen Romanfassung auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis.
Zwei Welten, Ein Blick
In Vierundsiebzig verbindet Othmann historische Recherche mit autobiographischen Elementen. Sie berichtet von eigenen Reisen in das Herkunftsland ihres Vaters, von Begegnungen mit Verwandten und Zeug:innen der Gewalt. Diese persönliche Perspektive verleiht dem Buch eine besondere Tiefe: Es ist keine bloße Nacherzählung eines weit entfernten Konflikts, sondern eine literarische Auseinandersetzung mit einem Verbrechen, das auch Teil ihrer eigenen Familiengeschichte ist. Auch das Gefühl der Scham zieht sich durch, denn die Protagonistin ringt mit der Tatsache, in Deutschland zu leben, während ihre Verwandten in Shingal um ihr Leben fürchten müssen.
»Aber nachts lag ich in meinem Bett und mein Onkel im Graben. Und über mir war die in den Stuckecken mit Staubfäden verhangene Zimmerdecke. Und hinter meinem Onkel waren die Granatäpfel- und Mandelbäume, die mein Vater gepflanzt hatte.«
Schreiben, wenn die Sprache fehlt
Stilistisch fällt der Roman Othmanns durch seine nüchterne, sachliche Sprache auf. Die Autorin dokumentiert, ohne zu kommentieren – und gerade dadurch entfaltet der Text eine große emotionale Wirkung. Die Sprachlosigkeit angesichts des Unvorstellbaren zieht sich wie ein roter Faden durch den Roman. Die Suche nach Worte für das Grauen wird selbst zum Thema. Kurze Sätze, fragmentarische Gedanken spiegeln das Verstummen – Othmann nutzt eine Sprache, die weniger sagt als fühlen lässt.
»Was ich schreibe, hat keine Ordnung. Worte, Sätze, die abbrechen, im Nichts verlaufen […] Ich habe keine Sprache.«
Zwischen Geschichte und Erinnerung
Die Struktur des Buches ist anspruchsvoll. Es kommen viele verschiedene Personen zu Wort, diese erzählen ihre Geschichten oft in kurzen, fragmentarischen Episoden. Das kann verwirrend wirken. Doch mit der Zeit wird deutlich: Es geht nicht darum, jede Figur, jedes Detail zu erinnern. Aus den vielen Erzählungen entsteht ein vielschichtiges Bild, das zeigt, wie eng die Familien verbunden sind und wie weit ihr Gefühl von Zusammenhalt reicht. Der mittlere Teil des Romans ist stellenweise dicht und historisch ausgreifend, was Leser:innen überfordern könnte. Jedoch sind diese Passagen notwendig, um die lange Geschichte der Verfolgung der Êzîden zu verstehen. Der letzte Teil des Romans schildert die Reise zu Recherchezwecken der Protagonistin mit ihrem Vater in dessen Heimat. Dabei wird deutlich, wie tief die Vergangenheit im Leben der Figuren verankert ist und ihre Gegenwart prägt. Die Begegnung mit dem Herkunftsort ist von Schmerz, Erinnerungen und stiller Verbundenheit geprägt.
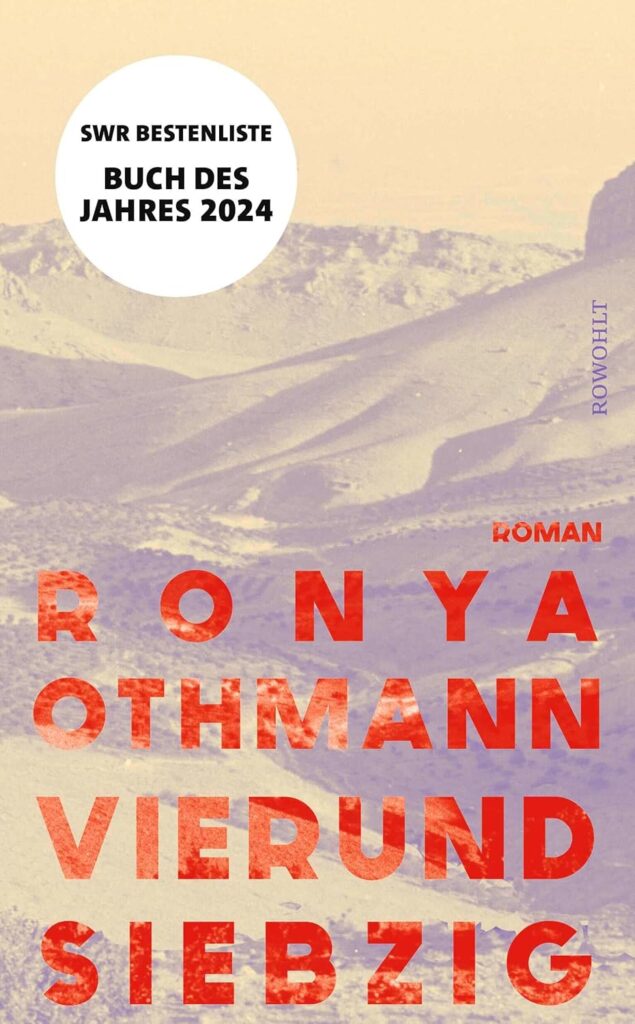
Vierundsiebzig
Rowohlt: 2024
512 Seiten, 26 €
Erst am 19. Januar 2023 erkannte der Deutsche Bundestag den Genozid an den Êzîden offiziell an – fast ein Jahrzehnt nach dem Verbrechen. Dass diese Anerkennung so spät erfolgte, zeigt, wie wenig Aufmerksamkeit dieser Völkermord in Deutschland und Europa bislang erfahren hat. Genau deshalb ist ein Roman wie Vierundsiebzig so wichtig. Es klärt auf, gibt den Betroffenen eine Stimme und verhindert das Vergessen.
Ronya Othmann hat mit dem Werk Vierundsiebzig ein Werk geschaffen, das historische Fakten, persönliche Erinnerungen und politische Dringlichkeit miteinander verbindet. Es ist ein bedeutsamer Roman – berührend, erschütternd und von großer gesellschaftlicher Relevanz.







This review beautifully captures the emotional depth and historical significance of Vierundsiebzig. Othmanns stark, fragmented prose powerfully conveys the horror of the genocide and its personal impact. A vital, moving read that demands attention.
The review beautifully captures the emotional depth and historical significance of Othmanns work. Its a powerful testament to the Êzîden tragedy and the importance of giving voice to marginalized stories. Highly recommended.