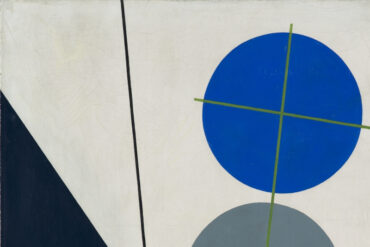Triggerwarnung: Erwähnung rassistischer Gewalt
Die Regisseurin Mala Reinhardt bot im Lumière am 13. Januar 2020 eine bewegende Geschichte rassistisch motivierter Gewalt. Ihr Dokumentarfilm nimmt konsequent die Perspektive der Betroffenen ein, für die »der erste Anschlag« erst der Anfang ihrer Schmerzen ist.
Von Linus Lanfermann-Baumann
Bild: mit freundl. Genehmigung ©PRSPCTV Productions
»Als Person of Color in Deutschland war ich von Kindheit an mit Fragen zu meiner eigenen gesellschaftlichen Zugehörigkeit konfrontiert« – so beschreibt Regisseurin Mala Reinhardt ihr ganz persönliches Verhältnis zu ihrem jüngsten Film Der zweite Anschlag. Sie berichtet von der Konfrontation mit »ständigen Fragen« nach ihrer Herkunft und »verbalen Angriffen in der Öffentlichkeit«. Rassismus ist ihr nicht fremd, denn sie hat ihn selbst erlebt. Obwohl in Deutschland geboren, habe das oft nicht ausgereicht, um als zugehörig wahrgenommen zu werden.
Damit hängt es wohl auch zusammen, dass Reinhardts 62-minütige Dokumentation über rassistisch motivierte Gewalt in Deutschland in unnachgiebiger Konsequenz die Perspektive der Betroffenen einnimmt. Täter*innen, Beamt*innen oder Wissenschaftler*innen werden kaum erwähnt – es sei denn, den Betroffenen ist dies selbst ein Bedürfnis. Interviewfragen hört man nicht, die Opfer erzählen mit größtmöglicher Freiheit. Die Inszenierung ist sehr ruhig, mit langen Einstellungen und dezenter Hintergrundmusik. Kein Voice-Over, keine Kunstschnitte. Reinhardt macht vor, wie gefühlvoll man ein so erschütterndes Thema inszenieren kann: Der Fokus liegt ganz auf den persönlichen Geschichten der Interviewten.
Fremd im eigenen Land
Da ist zunächst Mai Phương Kollath, Zeugin der rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen 1992, die sich zunächst gegen die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, dann schnell gegen das benachbarte, von vielen Vietnamesen bewohnte »Sonnenblumenhaus« richteten. Als Vertragsarbeiterin kam Mai Phương in den 1980ern in die DDR und lebte jahrelang in eben diesem Sonnenblumenhaus. Eigentlich war ihr Verbleib begrenzt und sie stand schon kurz vor der Rückreise nach Vietnam – bis sie sich in einen deutschen Mann verliebte. Und der Preis der Liebe war hoch: Um die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen zu können, gab sie die vietnamesische auf. Sie war nun offiziell »Deutsche«.
Umso bewegender ist es, wenn sie von dem Moment erzählt, als sie in das verkohlte Hochhaus zurückkehrte. Die Erinnerung rührt sie noch Jahrzehnte später zu Tränen. Denn in diesem Moment wurde ihr klar, dass ihr Pass nicht reichen würde, um von allen akzeptiert zu werden: Ihr Gesicht würde sie niemals ändern können. Wie ihre vietnamesischen Bekannten, die 1992 Opfer der tagelangen Belagerung durch Rechtsextreme und Schaulustige wurden, während Polizisten und Feuerwehr sich zurückzogen. Zwar starb damals wie durch ein Wunder niemand, aber bei Menschen wie Mai Phương Kollath wirkt die Gewalt bis heute nach.
»Der zweite Anschlag«
Das titelgebende Zitat stammt vom zweiten der drei Protagonist*innen. Ibrahim Arslan war sieben Jahre alt, als er, ebenfalls 1992, den Brandanschlag auf zwei Häuser in Mölln überlebte. In nasse Decken eingewickelt – er vermutet, dies hat er seiner Großmutter zu verdanken – konnte er gerettet werden. Während im zuerst attackierten Haus niemand starb, verlor Ibrahim Arslan in dieser Nacht Schwester, Cousine und Großmutter. »Zum Glück«, sagt er, erinnere er sich nur noch an brennende Töpfe und nicht an den Todeskampf seiner Verwandten. Er ist gefasst, redet offen. Er hat dies schon öfter getan, das merkt man.

Der physische »erste Anschlag« sei schrecklich gewesen, sagt er, doch noch schlimmer der zweite. Derjenige nämlich, der von der Gesellschaft ausging, von Politik, Justiz und Medien. So stellten die Behörden die Familie etwas später vor eine absurde Wahl: Entweder solle man in ein Asylantenheim ziehen oder wieder das gleiche Haus wie zuvor bewohnen. Sein Vater, ein türkischer Gastarbeiter, war verständlicherweise empört ob dieser zwei Optionen – und entschied sich für die letztere. Ibrahim wuchs weiter in dem Haus auf, in dem seine Angehörigen ihr Leben verloren, lief jeden Tag die Treppe hinauf, auf der seine Großmutter verbrannt, schaute aus dem Fenster, aus dem seine Mutter gesprungen war. Als die Stadt Mölln eine Gedenkveranstaltung beschließt, wird Familie Arslan bizarrerweise nicht eingeladen. Heute gibt es zwei solcher Veranstaltungen: die offizielle und die der Betroffenen.
Die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen und der Möllner Brandanschlag waren lediglich Teil einer Serie weiterer rassistisch motivierter Übergriffe Anfang der 1990er. 1991 etwa gab es massive Ausschreitungen im sächsischen Hoyerswerda, die sich gegen Wohnheime von Geflüchteten und Vertragsarbeiter*innen richteten und bundesweite Strahlkraft hatten. Im nordrhein-westfälischen Hünxe überlebte ein achtjähriges Mädchen den Anschlag auf das dortige Asylbewerberheim nur knapp, während ein Mordanschlag Rechtsextremer in Solingen 1993 die Leben von fünf Menschen türkischer Abstammung forderte. Die bedrückendste Welle rassistisch motivierter Gewalt seit dieser Zeit begann dann Ende des Jahrzehnts: Der Nationalsozialistische Untergrund formierte sich und begann bald seine Mordserie.
Keine Hoffnung auf Aufklärung
Ein guter Freund Ibrahim Arslans ist heute Osman Taşköprü. Die beiden verbindet ihr persönliches Schicksal. Osman ist der Bruder von Süleyman Taşköprü, der 2001 in Hamburg Opfer des dritten NSU-Mordes wurde. Osman ist vielleicht der aufgewühlteste der Interviewten. Er kann sich kaum noch an den Tag erinnern, an dem er seinen Bruder verlor. Als er am Tatort die Nachricht von dessen Tod erhielt, sei er wohl wild auf die anwesenden Polizisten losgegangen. Nachdem er die Ereignisse am Tag des Mordes geschildert hat, trinkt er einen großen Schluck Wasser und bittet sichtlich mitgenommen darum, das Interview zu pausieren.
In seinen Kulturkreisen, sagt er, sei ein Onkel fast wie ein zweiter Vater. Er freue sich jedes Mal, wenn er die Tochter seines ermordeten Bruders sieht: »Es ist gut, dass sie da ist.« Nach der Tat geraten Osman und sein Vater zunächst selbst in den Verdacht der Polizei, werden stundenlang verhört. Hoffnung auf vollständige Aufklärung macht Osman sich heute keine. Angela Merkel habe ihm dies zwar bei einem gemeinsamen Essen versprochen. Doch außer einigen Jahren Haft für Beate Zschäpe und die wenigen Mitangeklagten erwartet er keine weiteren Entwicklungen, keine Erkenntnisse, die die Ereignisse 2001 noch erleuchten werden.

Auf dem NSU-Tribunal in Köln 2017 traf Osman auf andere Betroffene. Verschiedene Initiativen organisierten die Veranstaltung, aus Solidarität mit den Opfern, nach dem Motto: Wenn der Staat nicht anklagt, tun wir es. Die Kontinuität rechter Gewalt und das staatliche Versagen werden betont, es kommen weitere Betroffene und Hinterbliebene zu Wort: Gülüstan Ayaz-Avcı zum Beispiel, die hochschwanger war, als ihr Verlobter, der eigentlich Kinderspielzeug kaufen wollte, 1985 von Neonazis ermordet wurde. Oder eine Holocaust-Überlebende, die den Aufstieg der AfD »unter dem Deckmantel der Demokratie« verurteilt und die Probleme mit Rassismus nicht in der Vergangenheit oder Zukunft verortet, sondern festhält: »Wir sind mittendrin.«
»Manche mögen halt keine Ausländer«
Als der Film am 13. Januar 2020 im Göttinger Lumière gezeigt wird, ist Patrick Lohse vor Ort – er war Bildgestalter, Kameramann und Produzent des Films. Zwar ist es unmittelbar nach der Vorführung sehr still im Saal, viele Zuschauer*innen gucken sich oder die Leinwand an und müssen sich erst einmal berappeln, nur wenige tuscheln leise. Doch bald gibt es Fragen zur Entstehung des Films. Schon länger sei klar gewesen, sagt Lohse, dass man einen Film über rechte Gewalt machen werde. Während der Recherche habe man eine entscheidende »Lücke« entdeckt: In vorhandenen Dokumentationen kam die Perspektive der Betroffenen gegenüber den Perspektiven der Ermittler, der Täter und der Justiz oftmals viel zu kurz. Daher habe man die Entscheidung getroffen, die Sicht der Opfer zu präsentieren.
Dass das Endprodukt »nur« 62 Minuten Länge hat, begründet er auch. Nach der Vorstellung sollte es noch Kraft zur Diskussion geben, niemand sollte vom langen Sitzen vor Erschöpfung und Hunger vorher aus dem Kino fliehen. Entsprechend wird der Film auch eingesetzt, an Polizeiakademien etwa oder in Schulen. Ein Kind habe einmal gesagt »Manche mögen halt keine Ausländer«, und das müsse man akzeptieren. Lohse selbst habe gar nichts dazu sagen müssen: Den Mitschüler*innen selbst, die den Film zuvor gesehen hatten, sei es wichtig gewesen, selbst sofort das Wort zu ergreifen und die Aussage zurückzuweisen.
Eine andere Art, zu erzählen
Film
Der zweite Anschlag (2018) ist ein 62-minütiger Dokumentarfilm über die Geschichten von Betroffenen rassistischer Gewalt in Deutschland. Als Teil einer Veranstaltungsreihe des Bündnisses zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus wurde er in Kooperation mit Amnesty International am 13. Januar 2020 im Göttinger Kino Lumière aufgeführt.
Claude Lanzmann, Regisseur der monumentalen Dokumentation Shoah, hat einmal gesagt, ein Werk, das dem Holocaust gerecht werden wolle, müsse zuerst mit der Chronologie brechen. Eine chronologische Herleitung nämlich suggeriere in ihren kausalen Verknüpfungen Erklärbarkeit, Harmonie – der Holocaust verliere so seine Skandalwirkung. Lanzmann folgte dem und drehte mit Shoah eine Dokumentation, die Betroffene (und auch Täter) erzählen lässt – ohne sie unter Druck zu setzen, ohne sie zu schneiden, ohne große Meistererzählungen, die die nationalsozialistischen Verbrechen erklären sollten.
Der zweite Anschlag verfolgt einen ähnlichen Ansatz, wenn auch in viel kleinerem Ausmaß. Niemand versucht zu erklären, wie es zur Militarisierung der rechten Szene kommen konnte, wie die Täter sich radikalisierten, wie eins zum andern führte. Stattdessen erzählen die Betroffenen ihre eigenen kleinen Geschichten. Im Sinne des französischen Philosophen Jean-François Lyotard ist Mala Reinhardts Dokumentation eine postmoderne. Im Vordergrund sind die Individuen mit ihren ganz persönlichen Erfahrungen. Der Untertitel ist daher nicht sehr gut gewählt: Eine Anklage der Betroffenen. Um die Anklage der Betroffenen geht es zwar auch, aber zuallererst: um ihre Geschichten. Umso mehr hallen die 62 Minuten Dokumentation nach.
Heute geben viele von ihnen ihre Geschichten weiter. Ibrahim Arslan zum Beispiel ist politisch sehr engagiert, arbeitet viel mit Schulklassen. Er lässt es sich auch nicht nehmen, sich selbst auf Rassismus hin zu überprüfen. Er weiß, dass nicht nur rechtsextreme Deutsche anfällig für Rassismus sind. Als Türke sei von ihm zum Beispiel erwartet worden, wie sein Umfeld einen Hass auf Kurden zu entwickeln. Daher untersucht er sich selbst ständig auf eigene Rassismen, und fordert dies von denjenigen ein, mit denen er seine Geschichte teilt. Mai Phương Kollath begann nach den Rostocker Ausschreitungen, in einem deutsch-vietnamesischen Verein zu arbeiten, heute ist sie als interkulturelle Beraterin selbstständig. Wie viele andere sind beide trotz traumatischer Erlebnisse ihren Weg gegangen und gehen ihn immer noch – wenn auch der »erste« und der »zweite Anschlag« ihre Spuren für immer hinterlassen.